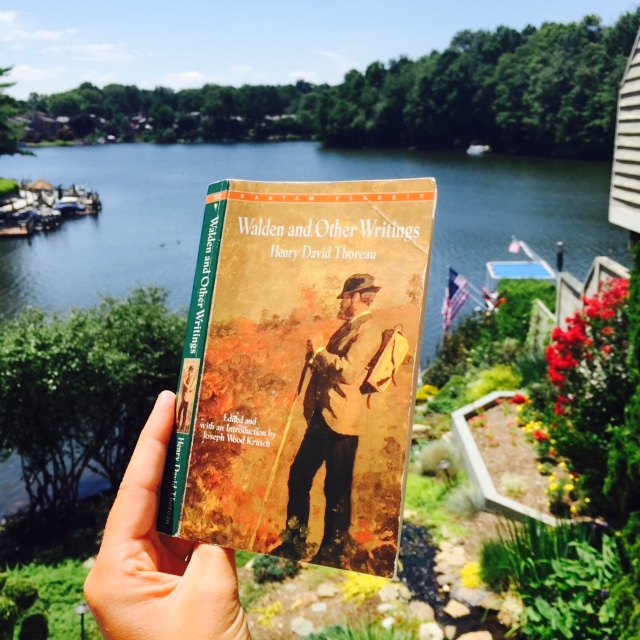Burgertasting. Und zwar „animal style“! Das ist der erste Geschmack Santa Barbaras. Wenn ich so über die Reise nachdenke, dann habe ich bisher tatsächlich erst ein oder zwei Burger gegessen. Ganz amiuntypisch! Also reingehauen. Erst bei In n‘ Out den animal style (ein Relish mit süßsauren Gurken, das steht nirgendwo dran – reines Insiderwissen!) Burger und animal style Pommes, ein paar Tage später ‚muss ‚ ich dann auch noch den Burger bei The Habit probieren. Der ist noch besser, mit kandierten Zwiebeln! Aber genug des Fastfoods…
Santa Barbara, das ist die Riviera Südkaliforniens, das „pleasantville“ des Golden State. Für mich ist es die Geschichte von Billy, dem Obdachlosen. Aber dazu später. In einer lokalen Zeitung lese ich, dass 60% der Mieter in Santa Barbara mehr als 1/3 ihres Einkommens für ein Dach über dem Kopf zahlen, 33% blechen sogar mehr als die Hälfte ihres Einkommens. Die Rede ist von einer Paradiessteuer, „paradise tax“ – the added cost of living along the South coast“. Das hier alles schickilacki ist fällt auch sofort auf, besonders weil ich vorher die Großstadt LA vor und in der Nase hatte. Apropos Großstadt: Die Busfahrt von LA nach Santa Barbara war wieder abenteuerlich. In der Greyhound Bus Station in Long Beach, CA ist der Bus schon über eine Stunde verspätet – ich warte seit 2,5 Stunden, weil ich schon früh aus dem Hostel aufgebrochen bin. Und ich warte nicht alleine: Da ist Aaron, der Soldat, der gerade von einer Beerdigung kommt und in ein paar Stunden von Las Vegas wieder nach Afghanistan fliegt. Da ist ein Haufen ungebändigter Kinder, die sich kreischend gegen den Süßigkeitenautomaten werfen und, als der keine Schokoriegel herausrückt, anfangen sich gegenseitig zu erwürgen. Drei ältere Damen mit chinesischem Antlitz unterhalten sich gedämpft auf Spanisch während sie das Treiben beobachten und dann ist da dieser alte Mann mit Hut. Ich weiß nicht, ob er besoffen oder einfach ein bisschen bekloppt ist, oder beides. Auf jeden Fall schreit und lallt er. Dabei klopft er immer wieder seinem halbstarken Sohn auf die Schulter. Der schleift genervt seinen Ziehkoffer ohne Rollen (!) hinter sich her, als er grinst blitzt Gold hervor, edle Schneidezähne! Als der Bus endlich eintrifft weigert der Alte sich ihn zu umarmen, „we don’t hug! we don’t hug!“, der Sohn verabschiedet sich mit Handschlag und einem demütigen „Bye, Sir“.
Santa Barbara empfängt mich mit offenen Armen, beziehungsweise sind es Gary und Steph die ihre Arme ausbreiten. Die Nummer auf der Serviette vom Nashville Airport ( http://www.blogmopped.com/2015/07/29/nashvegas/) erweist sich als goldwert, sie wandelt sich zu einer riesige Luftmatratze und einer noch größeren Portion Gastfreundschaft. Gary und Steph sind Geschwister, zwei von sieben, die in Santa Barbara aufgewachsen sind und noch immer hier leben. Bei ihnen im Wohnzimmer darf ich die nächsten Nächte meinen Schlafsack ausbreiten, duschen und mich wie zu Hause fühlen. Dabei hat mich eigentlich nur reine Zweckmäßigkeit nach Santa Barbara geführt. Nicht weit von hier, von Ventura, fährt das Boot hinaus zu den Inseln des Channel Islands National Park, mein eigentliches Ziel. Bis zu meinem Aufbruch sind es noch 2 Tage. Genug Zeit, um Santa Barbara zu erkunden. Vielleicht treffe ich ja Alfred Hitchcock, oder Justus, Bob und Peter? Existiert Rocky Beach eigentlich wirklich? Ich fahre mit dem Bus in die Stadt, die ständige Hintergrundkulisse der Stadt sind die Hügel des Los Padres National Forest. Und natürlich sind da die Palmen, die ihre langen schlanken Hälse wie Giraffen aus dem Cluster der Straßen emporstrecken, ein unverkennbares Merkmal Kaliforniens. Ich spaziere die schicke State Street entlang, alles blitzt, niedliche Läden reihen sich aneinander, die Stadt versprüht das Flair eines unbesorgten Sommerurlaubes. Bevor die Straße auf den bekannten Pier mündet brauche ich dringend einen Kaffee. Im Coffeeshop redet ein alter Mann mit der Kassiererin und während ich meinen Cappuccino bestelle wedelt er mit einer Postkarte auf der in großen Zahlen eine Telefonnummer geschrieben steht. Die Kassierin reicht ihm ihr Handy, offenbar kennen sie sich schon länger. Er witzelt über irgendwelche Geheimdienste, sagt er sei von der NSA und beide kiechern, „Oh Billy“, sagt sie kopfschüttelnd. Ich bekomme meinen Kaffee, setze mich draußen an einen Tisch und beginne Postkarten zu schreiben. Neben dem Nachbartisch hat jemand eine Art Einkaufswagen geparkt, eher Modell Hackenporsche, aber aus einem Drahtkorb, sodass ich den Schlafsack und die Decken sehen kann, die darin gestapelt sind. Zwei Minuten später lässt Billy sich auf den Stuhl neben mich plumpsen, greift eine Plastiktüte vom Deckenstapel im Korb und beginnt ein Subway Sandwich auszuwickeln. Er hat weißes Haar, das unter seiner schmutzigen Cap hervorschaut. Aus den Ohren wachsen ebenfalls kleine weiße Büschel, weiße Stoppeln im wettergegerbten Gesicht eines alten Mannes. Er trägt Shorts und ein kurzärmeliges Hemd, das bis zur Mitte der Brust aufgeknöpft ist – vielleicht fehlen aber auch die Knöpfe, ich kann es nicht erkennen. Auch die Arme und Beine sind sonnengebräunt, die Haut ledrig. Die Füße in Socken und Sandalen. Billy ist dünn, aber nicht abgemagert, eher zäh wie ein alter Opa, nur ein ganz kleines Bäuchlein ist übrig geblieben. Er sieht ordentlich aus, riecht nur ein bisschen ungewaschen, aber nicht aufdringlich. „Do you want this Subway Sandwich?“ fragt er und hält mir lächelnd das gefüllte Wrap entgegen. Seine Augen! Sie sind milchig, er fokussiert mich nicht beim Sprechen. „Oh, no thanks, I’m good, but thanks“ erwidere ich schnell. „You know I can’t really see. I see your teeth, you are smiling, I can see that. But I don’t see your eyes.“ Ich beobachte ihn wie er die Plastiktüte des Sandwiches ordentlich faltet, wenig später bläst der Wind sie vom Tisch. Er bemerkt es nicht, ich hebe sie auf, er bedankt sich und schiebt sie zwischen die Decken in seinen Korb. Auf der Suche nach Servietten greift er in die Tasche einer abgewetzten Lederjacke, früher habe er viele teure Sachen wie diese Jacke gekauft sagt er. Zu dieser Zeit haben wir uns bereits zwanzig, vielleicht dreißig Minuten unterhalten, meine Postkarten liegen halb beschrieben auf dem Tisch, mein Kaffee halb ausgetrunken längst kalt und vergessen. Billy erzählt von seinen Reisen, nach Asien und Europa. Als ich ihm erzähle ich komme aus Hamburg und schon ansetzen will zu erklären wo das in Deutschland liegt, fragt er bereits nach dem großen Hafen. Die Art wie er sich ausdrückt, das Wissen was er hat – er ist sehr schnell klar, dass Billy alles andere als ungebildet ist. Und doch sitzt er hier mit seinem Karren und ist ganz offensichtlich obdachlos. Ich kann nicht anders, ich muss ihn fragen: „Billy, may I ask you this“, beginne ich, vorsichtig und höflich, es ist mir ein bisschen unangenehm, ich weiß nicht wie er reagieren wird, „Why don’t you have a home? What happened to you?“ Er lächelt mich an, „You want me to tell you my story?“ Yes! Und so beginnt es, wir sitzen weitere zwei Stunden auf den Stühlen des Kaffees, Menschen strömen vorbei in der warmen Mittagssonne Santa Barbaras, manche schauen uns seltsam an. Er erzählt, ich höre zu, frage hier und da nach. In der Kurzfassung: Billys Leben ist nie ein standhaftes gewesen. Er wuchs in Nordtexas auf, heiratete mit 19, doch die Ehe hielt ein paar Jahre, danach lebte er alleine, hier und da eine Beziehung, nichts ernsthaftes. Nach dem College führten ihn verschiedene Jobs überall hin, „I technically lived everywhere in the States“. Billy ist ein Geschichtenerzähler, ich bin mir sicher er schmückt einiges aus, aber er wirkt nicht verrückt, all das scheint glaubhaft, Er arbeitete als Maler, als Fliesenleger, war Folksänger und Gatekeeper, einmal für ein paar Jahre auch professioneller Termiteninspektor für die Stadt LA. Und zwischendurch stopfte er Tiere aus, für Sammler. Er hatte immer Arbeit, immer Geld. Vor allem auch Zeit um zu reisen. Mit 40 ging er nach New Orleans, begann dort für eine vermögende Frau Immobilien zu verwalten und in Stand zu halten. Sie vermachte ihm in dieser Zeit ein altes Haus, heruntergekommen und leerstehend. Er sollte er herrichten und für sich selbst nutzen. Billy steckte eine Menge Arbeit, Sorgfalt und Geld in das Projekt, seine Altersvorsorge, sein Platz für den Lebensabend. Zwei Tage vor der Fertigstellung seines Hauses traf Hurrikane Katrina New Orleans. Das war 2005. Ab dann ging es bergab. Ein paar Jahre in Austin Texas, dort brachten ihn die Rettungskräfte hin, ein Job als Eisenbahnfahrer für Kinder in einem Freizeitpark, mit 62 der einzige Job den man ihm noch anbot, eine günstige kleine Wohnung in einem Hochhauskomplex in einem internationalen Viertel, „my neighbors were all Mexicans, lovely people“. Dann kamen die Investoren, kauften die Häuser und hoben die Miete um mehr als 400 Dollar. Heute ist Billy 72 und lebt auf der Straße in Santa Barbara. Er erhält ein bisschen Sozialgeld, aber für eine Wohnung reicht das nicht. Die Obdachlosenshelter gefallen ihm nicht, er schläft lieber in einem Park. Gestern Nacht ist sein Schlafsack nass geworden, weil die Sprinkleranlage plötzlich losging. Er lacht als er das erzählt, er sollte es mittlerweile wissen, sagt er. Er steckt sich den Rest Subway Sandwich in den Mund, wischt mit den Servietten die Mundwinkel sauber. „Do you want desert? These cookies are really good, they put this cream in them, vanilla I believe.“ Ich erkenne die Plastikverpackung des 99 cent stores in dem ich ein paar Vorräte für meinen Inseltrip gekauft habe. Er zeigt mir seine Essenskiste, ein schuhkarton mit Keksen, Scheibletten Käse und zwei Pakete Yum Yum Nudeln, alles akkurat einsortiert. Ich schüttle wieder den Kopf, mein Herz wird immer schwerer. Dieser alte Mann ist so gutmütig, kein Stück verbittert, trotz seines Schicksals. „You can get good Fish n‘ Chips out on the pier, you know, the Moby Dick Place, it’s not expensive.“ Das werden die nachdenklichsten Fish n‘ Chips, die ich jemals gegessen habe. Die Begegnung sitzt mir in den Knochen. Als ich gehe habe ich einen Kloß im Hals und in Billys milchigen gutmütigen Augen meine ich spiegelt sich eine Träne. Wir wissen beide, dass wir uns nicht wiedersehen. Dass diese Stunden eine besondere Begegnung waren, die bald nur noch eine Geschichte sein wird. Für mich die Geschichte eines Schicksals, ich werde nicht erfahren was mit Billy passiert. Seine Geschichte geht mir nahe, ich empfinde eine grausame Hilflosigkeit, ich kann nichts tun um ihm zu helfen. Nur zuhören. Santa Barbara ist seit dem für mich die Geschichte von Billy, the homeless guy. Später erzähle ich Gary und Steph von meiner Begegnung. Gary, der als Rettungssanitäter in der Stadt arbeitet und viele Obdachlose sogar beim Namen kennt, meint Billy zu kennen. Ein Unfall vor ein paar Monaten, Billy sei einfach über die Straße gelaufen. Ein Beinbruch, ich erinnere dass Billy so etwas erzählt hat. Armer alter Mann.
Ich packe meinen Rucksack und verlasse Santa Barbara für drei Nächte, um den CINP zu erkunden (https://blogmopped.com/2015/08/05/rough-and-remote-stormy-and-sandy-santa-rosa-island-ca/). Ein paar Sachen kann ich hier in der Wohnung lassen. Bei meiner Rückkehr gewähren mit Gary und Steph weitere zwei Nächte Unterschlupf. Ich bin so dankbar für diese bedingungslose Gastfreundschaft. Am letzten Abend erzählt Steph (Gary muss leider arbeiten) mir bei Lasagne und Rotwein – zumindest ein Versuch mich für die Gastfreundschaft zu bedanken! – die Geschichte hinter ihrem Nashville Ausflug: Die Beerdigung ihres Großvaters. Er hatte immer ein offenes Haus für Fremde und Reisende, „open door policy“, sagt Steph. Vielleicht war Garys Impuls mir die Nummer aufzuschreiben daher gekommen. Sie sagt, dass nachdem ich angekommen bin, Gary und sie sich angesehen und gegrinst haben, „Aren’t we the grandchildren of our grandfather?“. Mir gefällt die Geschichte. Alles ist Zufall und doch alles verknüpft. Dass sich in dieser Situation unsere Wege kreuzten, manche Dinge kann man einfach nicht planen.





 Thank you, Steph and Gary!
Thank you, Steph and Gary!