




Drei schwarz-weiße Kühe drängen sich in eine blätterüberdachte Ecke ihrer Weide, ich denke nicht, dass sie falsch liegen in ihrer Einschätzung des Wetters. Da braut sich etwas zusammen. Sich türmende Wolke, dunkelgrau erbost und ein Wind, der den Ärmel meiner ultradünnen shakedry Jacke von mir wegpustet als ich versuche galant hineinzuschlüpfen. Da plattert es auch schon vom Himmel, aber ich bin gut eingepackt und fühle mich frei und wild und wunderbar im Rausch durch den Regen.
200km auf dem Rad, von Kiel in ein kleines Dorf in Mecklenburg-Vorpommern. Eine Gelegenheit. Wind von hinten, ein Ziel vor Augen – ein vielversprechendens Mikroabenteuer in dieser faden Coronarealität. Ein Egoboost, vielleicht auch das. Und sicher ein Gegenstatement – gegen das innerliche Gehetze. Stunde um Stunde kurbeln, aushalten, durchhalten, laufen lassen. Bikepacking. Ankommen, wo man nicht losgefahren ist. Es ist mir schmackhafter als Kreise zu ziehen oder die Analogie von Hin- und Rückweg – auch wenn die Welt auf den selben Wegen, aber rückwärts, im Allgemeinen ein wenig anders aussieht. Herausforderung angenommen, ‚gut Tritt‘ also, so sprechen die Experten im Jargon der rennradfahrenden Gemeinschaft. Female fearless cyclist.
Von West nach Ost. Ich rolle durch den Kreis Plön, durch das malerische Eutin, an die Lübecker Bucht. Die Coronastille in diesen touristischen Gemeinden verblüfft mich. Keine Menschen, kein Wind – der Ostsee macht seinem Namen wieder alle Ehre. Dann Travemünde und eine Fährfahrt über den Fluss. Jetzt weiß ich auch was der Priwall ist. Dann Wechsel. Transition. Mecklenburg-Vorpommern. Ein kurzes Versorgungstreffen mit meinem Begleitfahrzeug nach 100km. Pipi und Pausenbrot und ein kleines Pläuschchen. Ich komme langsamer voran als gedacht, obwohl mein Schnitt bei, für diese Tour akzeptablen, 26,1km/h hält. Städte, Navigation, you name it.
150km und ich sage mir: Komm, läppische 50km, eine kurze Sonntagsausfahrt. Aber so viel Lust habe ich nicht mehr. Ich verspreche mir den letzten schokoladenummantelten Mandelriegel für die letzten 30km. Die Landschaft zieht vorbei, unbekannte Ortsnamen. Nochmal ein Schauer. Und zwei Mini-Shetlandponies in einem Mini-Vorgarten. Bei Kilometer 170 habe ich die Strecke von Paris- Roubaix erreicht. Vor mir erstreckt sich eine Pflasterlandschaft grober Unebenheiten. Heiliger Bimbam. Kack Navi. Grober Unfug, wer braucht sowas? Erschütterungen bis ins Mark, mein armes Fahrrad. Und den Platten sehe ich bereits vor mir. Nach einem knappen Kilometer ist der Spaß vorbei. Nie habe ich eine glatt asphaltierte Straße mehr zu schätzen gewusst. Den Riegel habe ich verdient. Kurze Pause.
Es sind gar nicht die Oberschenkel, die haben noch Kraft. Es ist eine Allianz aus Po, Rücken und Schultern, die gemeinsam protestiert. Auf den letzten 30 strecke ich mich alle zwei Minuten aus dem Sattel, ungemütliches finish. Erst bei 10 beginnt die Euphorie. Und dann der Dämpfer: 5km vor dem Ziel checke ich nochmal die Karte. Ja, ich weiß, dass es meinen Zielort zweimal gibt – in Schleswig-Holstein und in Meck-Pomm. Aber, dass es ihn noch ein drittes Mal gibt, nochmal in MeckPomm, um die 20 km entfernt von seinem bundeslandselben Namensvetter – wow! Da stehe ich nun, 202km auf der Uhr, und noch 20km weg vom Ziel, das mir so nah schien. Einrollen wollte ich, mit Fahnen und Trompeten. Unter die Dusche und an den Esstisch plumpsen. Pustekuchen! Aber ich habe das beste Begleitfahrzeug der Welt und werde abgeholt, die 20 extra bleiben mir erspart. Es dämmert auch schon. Wenig später plumpse ich erstmal dankbar in den Sitz des VW Busses und mit ein bisschen Verspätung folgt auch die Dusche und der Grillabend. Eastbound200 (202 !), die ersten 200 am Stück, geschafft!



 Wildwechsel. Auf dem Fahrrad. Das hatte ich noch nie. Von links springt plötzlich ein Rudel Rehe (laut Jägersprache -online-Lexikon bezeichnet man eine Gruppe Rehe auch als Rudel, wenn das der Wolf wüsste) auf die Fahrbahn. Hektisch, eher schon panisch, steuern sie in raumgreifenden Sprüngen auf den Knick der anderen Straßenseite zu, um dann dahinter über das Feld zu verschwinden. Eine kurze Begegnung, die mir völlig aus der Welt zu sein scheint. Dabei ist nichts mehr IN der Welt als ein Rudel Rehe auf einem nebligen Feld irgendwo in Schleswig-Holstein. Lovin‘ it. Mehr davon.
Wildwechsel. Auf dem Fahrrad. Das hatte ich noch nie. Von links springt plötzlich ein Rudel Rehe (laut Jägersprache -online-Lexikon bezeichnet man eine Gruppe Rehe auch als Rudel, wenn das der Wolf wüsste) auf die Fahrbahn. Hektisch, eher schon panisch, steuern sie in raumgreifenden Sprüngen auf den Knick der anderen Straßenseite zu, um dann dahinter über das Feld zu verschwinden. Eine kurze Begegnung, die mir völlig aus der Welt zu sein scheint. Dabei ist nichts mehr IN der Welt als ein Rudel Rehe auf einem nebligen Feld irgendwo in Schleswig-Holstein. Lovin‘ it. Mehr davon.
Ich sauge die Stille des Samstagmorgens auf während ich zyklisch-monoton vor mich hintrete und stelle einmal wieder fest, dass ich in meinem Leben zu viele Sonnenaufgänge verpasse. Frühes Aufstehen wird unterschätzt. Warum nicht häufiger so?
Der Anfang war dunkel und nass, viel Wasser auf der Straße als ich um 7:15 Uhr aus Kiel raus via Gaarden fahre. Zum Glück habe ich halbherzig recherchiert, der Wetterbericht meines iPhones war mir genau genug, da war bloß eine Wolke abgebildet. Hätte ich den Regenradar verfolgt, vermutlich wäre ich doch auf das Auto umgestiegen. Irgendwo bei 40km habe ich ein kleines Tief, meine Beine sind locker, aber mein Kopf ist müde und schwer. Solange bis das erste Schild mit einer konkreten Kilometerangabe kommt: Oldenburg i.H. 17km. Ab dort geht es streckenverlaufsmäßig weiter geradeaus, emotional aber bergauf. In diesem Hoch erreiche ich mein Ziel. Kiel – Oldenburg. Dann duschen und Frühstückspause mit Freunde-Klönschnack. Dann wieder aufs Rad, retour: Oldenburg – Kiel. Die Rücktour verläuft erstaunlich locker, die Beine laufen mechanisch, aber rund. Nur ab und zu überkommt mich ein kleiner Panikschub, dass meine Reifen dem Wintersplit zum Opfer fallen und ich steuere konzentriert zwischen den Steinchen hin und her. Auf die letzten 20km gibts noch ein Motivations-Nutellabrot aus der Packtasche. Langsam schwindet das Licht, das heißt: Licht an, die letzte halbe Stunde trete ich im Dunkeln bis vor die Haustür.
Geschafft. 136 km. 2 x 68. Keine Heldentat, bei Weitem kein long-distance ride, aber ich fühle mich heroinisch (und auch wie auf Droge), weil ausgepowert und zufrieden und mit mir und der Welt im Reinen. Mikroabenteuerliebe. Für mehr Makroabenteuer: http://theadventuresyndicate.com/emily-chappell
#fearlessfemalecyclist #keinegnadefuerdiewade #guttritt

Trainingstagebuch
Sonntag, der 20. Januar 2019
Der Hasselbrack, 116m ü.N.N. Was für ein Gipfel. Diese Höhenlage nennt sich höchste Erhebung Hamburgs. Wie soll ich hier trainieren? Für einen Lauf, der einem 1400 Höhenmeter abverlangt. Meine Füße ertasten in rhythmischer Fortbewegung den Waldboden, jede Wurzel, jeder Stein wird registriert. Ich laufe mit meinen Füßen, sie sind in dieser Umgebung mein Zentrum der Wahrnehmung. Das Ligamentum fibulotalare anterius ist zum Zerreißen gespannt, schon dieser norddeutsche Pseudotrail fordert höchste Konzentration. Um mich herum ist der Wald sich selbst genug. Vögel flattern nur vereinzelt, Raureif liegt noch auf den Tannen. In der Nacht hat es gefroren. Meine Oberschenkel sind so hart wie der Boden, jede Sandanhäufung am Boden ist erstarrt wie eine Welle im Eismeer, die Rillen des Waldarbeiterfahrzeugs steinhart gefroren, in den Löchern glitzern kleine Schlittschuhseen. Ich bin tief im Wald, meine komoot App lotst ich den Trail entlang, ich biege ab und bin plötzlich 90m neben der geplanten Route, dann 120m und dann sagt die Stimme gar nichts mehr. Ein Blick auf die virtuelle Karte, der Weg durchs Unterholz und ich erreiche den richtigen Pfad wieder. Besorgt registriere ich den niedrigen Akkustand des Telefons. Aus diesem Labyrinth finde ich nicht so ohne Weiteres wieder heraus. Die Kälte macht ein Stehenbleiben indiskutabel. Dieser Sonntagmorgenlauf wird allmählich zu einem Mikroabenteuer. Nach 10km schließt sich mein Kreis schließlich doch, ich gelange zur Wiese an der Waldkehre, wo nun erste Mountainbiker und Rentnerwandergruppen auftauchen. Dem Wald entronnen, das Außenband noch heil, der Trail im Chiemgau kann kommen. In vier Monaten werden hier keine Berge wachsen, aber die Füße sich auf unwegsamen Pfaden an die Unebene vielleicht herantasten.





Freitag, den 26. Januar 2019
Skifahren ist auch Höhentraining. Ein kurzer Ausflug in die Kitzbüheler Alpen. Ich hatte die Trailschuhe dabei, zu häufig aber die Skistiefel an.


Sonntag, den 17. Februar 2019
Kiel hat Brücken, die als Berge dienen. Zurücklaufen bedeutet durchhalten müssen. Auch, wenn der Untergrund nur wenig trail feeling bietet. Urbaner Trail bedeutet Asphalt zu laufen, dafür arbeite ich an der Grundlagenausdauer. Seit langer Zeit mal wieder 16, fast 17 Kilometer. Von Gettorf über die alte Levensauer Hochbrücke läuft es sich zumindest zeitweilig bergauf und bergab. Ich bezweifle dennoch, dass ich diese Einheit als Höhentraining verbuchen kann.




Mittwoch, den 20. und Dienstag, den 26. Januar 2019
Besser als kein Höhentraining ist zumindest über Bergsport zu sprechen. Eine Woche Banff Mountain Film Festival Tour erhöht sicher auch die Anzahl der roten Blutkörperchen. Es euphorisiert in jedem Fall den SportlerInnen auf der Leinwand zuzuschauen. Und dann bleibt doch noch Zeit einen Abstecher ins lang ersehnte Elbsandsteingebirge zu machen. Die sächsische Schweiz ruft mich aus Dresden zu sich. Früh am Morgen fahre ich die Elbe entlang, ein schmales Tal, rechts und links erheben sich steil die Ufer. Wer lebt hier? Alles wirkt ein bisschen tot, besonders die Farbe der wenigen Häuser. Das Navi führt mich bis Schmilka, von dort geht der Trail hinein in den Wald. Direkt führt er, noch im Ort, steil hinauf und ich denke mir, na bravo, meine Kondition kann sich so niemals bei einem Rennen sehen lassen. Aber ich beiße und quäle mich im Laufschritt den Berg hoch, Gehen nicht akzeptabel. Die aus dem Dorf hinausführende Asphaltstraße wird bald zu einem breiteren sandigen Fostweg und dann zu dem Trail, den ich mir erhofft hatte. 15km mit 500hm, das erste Mal ernstzunehmende Höhenmeter. Durch die Bäume fällt Sonnenlicht, ich frohlocke, genau die richtige Entscheidung. Ein paar Mal biege ich falsch ab, finde aber den Weg immer wieder. Meine Beine sind semi locker, aber die Atmosphäre ist der Knaller. Die Sandsteinformationen türmen sich wulstig abseits des Weges, manchmal führt mich die Route dicht an sie ran. und schlißlich stehe ich vor der ersten Leiter. Es geht hinauf, die platten Gipfel bieten eine fantastische Aussicht. Nicht ganz die Alpen, aber mehr Berg als die Hochbrücke in Kiel oder der Hasselbrack in Harburg. Am Ende des Weges, zurück im Dorf, entdecke ich meine Belohnung: Eine Biobäckerei, die angemessen große Kuchenstücke für 2,5 Stunden Trailrun anbietet. Zweites Frühstück. Bester Start in den noch jungen Tag.







Samstag, den 02. März 2019
Alternativtraining. Rennradtour von Hamburg nach Kiel, 90km Strampeln statt Laufen. Ich bin mir unsicher, ob meine Prioritäten nicht bei langen Läufen liegen sollten. Es sind nur noch … Wochen bis zum Chiemgau Trail Run und ich komme nicht recht in einen läuferischen Trainingsrhythmus. Aber wenn sich die Gelegenheit mal ergibt, dann muss man mit der crew aufs Rennrad steigen.

Freitag, den 08. und Samstag, den 09. März 2019
Andauernd ausdauerndes Alternativtraining. Ich komme weiterhin nicht ins Laufen. In Hirschegg bleiben die Trailschuhe auch in der Tasche stecken. Langlauf bringt mich aus der Puste und anschlißend auch noch die Skitour ins Hinterland. Dieses Alternativprogramm ist nicht gerade unattraktiv und von Faulheit kann auch keine Rede sein, aber ich mache mir allmählich doch sorgen um meine Lauffitness. Dann streckt mich eine Erkältung inklusive brennender Lunge noch die nächsten Tage nieder und an Laufen ist nicht zu denken. Nun gut, ab Ende März dann nochmal eneinhalb Monate so richtig strukturiert trainieren, denke ich mir, und schreibe wieder einen imaginären Trainingsplan für die Zukunft.


Freitag, den 22. März 2019
Sich den Freitag freizunehmen und trotzdem früh aufzustehen, ich dachte das machen alle Münchner fast jeden Freitag. Aber als wir gegen 8:30 Uhr ans Ende des Eng-Tals rollen stehen erst einige wenige Autos schief am Straßenrand halb in den Schneegraben geparkt. Glitzernd bricht sich die Sonne auf dem nicht mehr ganz so frischem Schnee – aber genug ist noch da. Wir entrollen die Felle, schlüpfen in die Skistiefel und testen den Lawinen Pieps. Dann führt uns die Spur der wenigen frühen Vögel auch schon hinein, in den Wald und schließlich in steileres, offenenes Terrain gen Gipfel. Die Beine arbeiten gut, ich bin mir sicher, dass ich diese Tour als lange Wochenendeinheit im Lauftagebuch verbuchen kann. Unterwegs lassen wir eine Hülle nach der anderen fallen bis wir auf dem Gipfel schlussendlich, sonnenhungrig wie in einem Skimovie aus den 80ern, nur noch in SportBH zum Bräunen im Schnee liegen. Rasant geht es dreifach so schnell bergab wie bergauf. Der angetaute Schnee ist so schwer, dass ich mich ab und zu zur Seit plumpsen lassen muss, weil meine Oberschenkel zu bersten drohen. Unten am Auto sind wir seelig. Kurz nach Freitag Mittag und schon glücklich, als ob man eine Woche im Urlaub gewesen wäre.






…noch 51 Tage bis zum Chiemgau Trail Run. Fokus. Auf das Laufen. Jetzt. Los. Auf gehts.
Bülk Nights (2014)
Wenn wärmende Strandtage zu feuernächtlichen Beach BBQs werden / Weil die Ostsee kein Bagger’see ist / sind wir ganz einfach in die Szenerie verliebt / die Romantik ölfarbend unsere Badesachen tränkt / Jazz sich mit der Sonne verbindet und tanzend hinter der Steilküste versinkt / Doch noch und das Licht nicht nimmt / lila glimmt / bis wir mit Lagerfeuer dem Leuchtfeuer ein Schnippchen schlagen.
Natur hat nur einen Gedanken / dass man nicht viel zum Leben braucht / und wir denken alle im Chor / „I’m gonna tell ma‘ momma, that I’m a traveller, I’m gonna follow the sun.“
Nach zwei Semestern auf der Turnfläche sind sie löchrig geworden. Schläppchen nennt man sie im Fachjargon, Turnschläppchen. Sie haben Schweiß von Anstrengung und Aufregung aufgesogen, wurden an- und ausgezogen. Seit Anfang Dezember 2017 fünf bis sechs Mal die Woche. Wir huldigten dem Gerätturnen wie einer Religion, die Turnhalle war unsere Kirche und wir pilgerten in diese heiligen Hallen wie fromme Leistungssportler. Donnerstag, der 08. Februar und ich habe keine Erleuchtung erlangt, aber Erleichterung errungen. Mich durchgerungen, die Turnprüfung, die gefürchtete, bestanden. BESTANDEN. Den Stufenbarren erklommen, beim Sprung das Pferd hinter mir gelassen, den Schwebebalken ausbalanciert und den Boden bezwungen. Bewegungen, die ich meinem Körper vor einem Jahr nicht zugetraut hätte, dahingeturnt, in kürgleich-choreografischen Bahnen. Und obwohl er dabei wohl nicht elfengleich aussah, dieser ballsportdressierte Körper, so sehe ich mich in meinem Innersten doch elegant über den Schwungboden schweben. Man lasse mir die Illusion der Eleganz. Mit gespitzten Füßen in Turnschläppchen darf man sich wie eine Ballerina fühlen. Einmal im Leben. Die Schläppchen werden mich daran erinnern, wenn ich sie nach Dekaden in meinem Schrank wiederfinde.
‚Passiv Schwimmen‘ nennt Herr von Düffel es, das ‚Sich-treiben-lassen‘. Im Rhein bei Basel, mit der Strömung flussabwärts treiben. Nicht mal dazu bringe ich es an diesem Sonntag. Dabei ist es unter der Markise auf der Terrasse kaum auszuhalten, die Kniekehlen schon feucht, ideales Freibadwetter wäre das. Im Kopf ziehe ich bereits meine Bahnen, stoße mich ab, lasse die Beine überklappen, Rollwende, und wieder gleitend auf neuer Bahn im kühlenden Chlorwasser. Schwimmprüfung in acht Tagen. Doch ich hänge hier fest und schaffe es nicht mal die paar Meter in den kühlenden Garten zu flüchten. Lethargie hat von mir Besitz ergriffen. Statt zu schwimmen schwimme ich passiv. Lasse mich treiben, nicht den Rhein hinab, auch nicht durch die nahe Alster, nur durch die Worte. Atme dabei das Chlor des Badeanzugs. Es scheint fast, als hätte ich es ins Schwimmbad geschafft.
 Wir sind eine Schicksalsgemeinschaft, die Banane und ich. Sie fürchtet erdrückt oder gegessen zu werden, dabei will ich mich nur an ihr festhalten. Sie ins Ziel tragen. Mein Magen würde sie ohnehin nach diesem 1,5km Chiemseehochseeabenteuer und den feuchtwarmen 40 hügeligen Radkilometern nicht vertragen. Die Banane, meine Begleiterin auf den letzten neun Kilometern. Sie wurde mir von einem freiwilligen Helfer am Verpflegungsstand gereicht. Nach dem ersten verflucht geraden Kilometer stand er da und hielt sie mir vor die Nase. Was konnte ich anderes tun als sie zu greifen? Sie war perfekt, eine wahre Paradiesfeige, dabei keine ganze. Man schnibbelt Bananen bei Wettkämpfen in 3-4 Stücke, Häppchen, mundgerecht für die Sportler. Ich hatte ein Endstück erwischt. Noch geschlossen auf der einen Seite, mit dem Staudenpinöpel dran. So wie Affen sie schälen, mit dem Pinöpel nach unten. Auf der anderen Seite offen, glatt abgeschnitten, mit Blick auf das gelbliche Fruchtfleisch. Bananen gehören, wer hätte das gedacht, als Früchte zu den Beeren und werden im botanischen Fachjargon Finger genannt. Ich hatte einen abgeschnittenen Finger, aber einen der sich ganz ausgezeichnet anfassen lies. Ich knetete und drückte, während die Kilometer stetig weniger wurden. Am Ende war sie schleimig geworden, nass. Und ein bisschen zu fest gedrückt hatte ich wohl auch. Sie fand ihr Ende in der schwarzen Mülltonne am Zieleinlauf. Hinter der Ziellinie wohlgemerkt. Das Rennen hatten wir zusammen gemeistert. Schicksalsgemeinschaft. Die Banane und ich. Beim Chiemsee Triathlon 2017.
Wir sind eine Schicksalsgemeinschaft, die Banane und ich. Sie fürchtet erdrückt oder gegessen zu werden, dabei will ich mich nur an ihr festhalten. Sie ins Ziel tragen. Mein Magen würde sie ohnehin nach diesem 1,5km Chiemseehochseeabenteuer und den feuchtwarmen 40 hügeligen Radkilometern nicht vertragen. Die Banane, meine Begleiterin auf den letzten neun Kilometern. Sie wurde mir von einem freiwilligen Helfer am Verpflegungsstand gereicht. Nach dem ersten verflucht geraden Kilometer stand er da und hielt sie mir vor die Nase. Was konnte ich anderes tun als sie zu greifen? Sie war perfekt, eine wahre Paradiesfeige, dabei keine ganze. Man schnibbelt Bananen bei Wettkämpfen in 3-4 Stücke, Häppchen, mundgerecht für die Sportler. Ich hatte ein Endstück erwischt. Noch geschlossen auf der einen Seite, mit dem Staudenpinöpel dran. So wie Affen sie schälen, mit dem Pinöpel nach unten. Auf der anderen Seite offen, glatt abgeschnitten, mit Blick auf das gelbliche Fruchtfleisch. Bananen gehören, wer hätte das gedacht, als Früchte zu den Beeren und werden im botanischen Fachjargon Finger genannt. Ich hatte einen abgeschnittenen Finger, aber einen der sich ganz ausgezeichnet anfassen lies. Ich knetete und drückte, während die Kilometer stetig weniger wurden. Am Ende war sie schleimig geworden, nass. Und ein bisschen zu fest gedrückt hatte ich wohl auch. Sie fand ihr Ende in der schwarzen Mülltonne am Zieleinlauf. Hinter der Ziellinie wohlgemerkt. Das Rennen hatten wir zusammen gemeistert. Schicksalsgemeinschaft. Die Banane und ich. Beim Chiemsee Triathlon 2017.
Palma stinkt! Mir nur ein bisschen, Ronja dafür sehr. Aber insgesamt erleiden wir schon einen ziemlichen Schock. Nach vier Tagen Naturerlebnis pur, Nächten im Wald und Duschen am Strand, erscheint uns die Hauptstadt Mallorcas wie der reinste Moloch. Der Stadtstrand, den wir hoffnungsvoll aufsuchen, ist grausam. Dahinter die vierspurige Straße, ist das Seenebel oder Smog, wir sind uns unsicher. Da hilft nur eine Bar. Wir pilgern weiter und finden in einem Estrella Damm. Der Nachmittag geht über in den frühen Abend. Wir müssen heute noch etwas durchhalten. Der Plan ist auf dem Flughafen zu nächtigen, da der Flieger schon morgen früh um sieben geht. Am besten hält man durch mit Essen. Wir suchen uns im Viertel Santa Catalina eine nette Tapasbar und schmausen bis es dunkel ist. Dann fährt der Bus und bringt uns an den Aeropuerto. Und zu unser wohl ungemütlichsten Nacht auf der Bank eines geschlossenen Foodcourts. Jeder Wald mit Getier wäre mir lieber gewesen als die brummenden Geräte, der piepsende Putzwagen und die schlurfenden Koffer. Trotzdem bleibt ein philosophischer Rest. Wir sind in transit. Kurz vor der Rückkehr in den Alltag nocheinmal zwischen den Welten, der Flughafen als Nichtort nährt in uns das Gefühl von Unkonventionalität. Die Idee von Abenteuer und Alternativen. Der nächste Mai wird kommen. Adios Mallorca, du Schöne!
LAY DAY. Heute machen wir nichts. Am Wasser liegen. Lesen. Essen. Bräunen. Nur eine kleine Wanderung am Morgen, hinauf zum Leuchtturm des Stadtteils Muleta. Wir entdecken, dass es dort oben eine niedliche kleine Bleibe für Wanderer gibt, das Refugi de Muleta. Unser Wilcampingplatz auf den Klippen ist allerdeings eigentlich nicht zu schlagen. Sowas von illegal und richtig gemütlich war es auch nicht, aber die Aussicht ist der Wahnsinn! Wir bummeln nachmittags durch das Hafenstädtchen und beschließen, dass wir für die Nacht noch weiterfahren wollen. Ein Bus bringt uns via Soller nach Valdemossa, ein romantisches Bergdorf mit Künstlerqualitäten. Schon Chopin hat sich hier zeitweilig niedergelassen und komponiert. George Sand hat geschrieben. Das fällt mir ein, dass ‚Ein Winter auf Mallorca‘ schon lange in meinem Regal steht und wartet gelesen zu werden.
Ronja übersteht die Busfahrt so mäßig. Irgendwann kommt sie matt wieder hinter einem Gebüsch hervor und möchte in diesem Moment wirklich nie wieder in so ein Gefährt einsteigen. Die Serpentinen waren tatsächlich brutal, der Busfahrer im Bremsen und Anfahren selten unsensibel. Ich kaufe Salzstangen und Cola, Erstversorgung für gebeutelte Bustouristinnen. Es wird langsam dunkler und wir müssen uns überlegen, wo wir schlafen wollen. Auf der Karte führt hinter der Bushaltestelle ein Weg ins Grüne. Wir laufen los, erst asphaltierte gassen mit Steinmauern, dann Gestrüpp, drehen wieder um, nehmen eine andere abzweigung, der Weg wird zu einem Trail, steigt an und führt uns in bewaldete Gefilde. Links Bäume, rechts trockene Weide hinter einer Steinmauer. Irgendwoher nimmt mein Körper an diesem Abend einen ganzen Batzen Energie und ich sprinte vor, um uns ein Plätzchen zu suchen. Wieder finde ich, wie schon bei Lluc, eine Moosplattform. Wir errichten unser Zelt. Als wir gerade fertig sind stehen zwei junge Leute vor uns, ein Pärchen aus Skandinavien. Sie schauen uns ein bisschen verwirrt an – das war doch ihr Platz. Ihre Rucksäcke liegen versteckt hinter Steinen, sie waren nur kurz in die Stadt hinabgestiegen. Wir verrücken also unser Zelt und teilen uns die Plattform. Mittlerweile ist es stockdunkel. Ronja kocht noch ein bisschen Brühe im Licht der Stirnlampe. Um uns herum nur Schwärze und Waldgeräusche. Wieder mal ein ganz anderer Schlafplatz. Wieder mal ganz nahm am Busen der Natur. unvorstellbar, dass morgen schon der letzte Tag anbricht.
Ironman in Port d’Alcudia heute. Überall hängen die Schilder. Wir scherzen noch, dass wir ganz froh sind heute keine diversen Kilometer schwimmen, radeln und rennen zu müssten. Hätten wir gewusst, was heute auf uns wartet. Ironman Qualitäten hatte dieser Wandertag streckenmäßig zwar nicht ganz, aber psychologisch war die Wanderung ziemlich strapaziös. Kurz und knapp: Die Etappe von Lluc bis Soller hat uns um die 30km bei voller Sonneneinstrahlung auf die Sohlen gespult, inklusive Blasen an fast jeder erdenklichen Stelle der Zehen. Wie kann man auch so blöd sein und nur mit Laufschuhen losziehen. Dazu machte uns eine ‚verseuchte‘ Quelle zu schaffen, auf die wir zwecks Trinkwasserversorgung gezählt hatten. Das hieß für die letzten 3-4 Stunden kein Wasser mehr. Feste Nahrung beschränkte sich auf eine letzte Dose Thunfisch und ein paar Mandeln. Ich war sowas von bedient! Ronja war gegenüber dieses Nahrungsmangels deutlich toleranter, ich dagegen war für ein, zwei Stunden richtig schlecht drauf. Aber wie die meisten nervigen Situationen stellte auch diese mich auf eine lehrreiche Probe. Irgendwann war ich selbst so genervt von meiner schlechten Laune inmitten dieses Paradieses, eine unerträglich Absurdität, dass ich mir selbst befahl mich zusammenzureißen. Du wolltest doch Abenteuer! Anstrengung! Unkonventionalität! Und immer die eine Frage: Bringt dich das was wir hier tun gerade um? Nein! Würdest du jetzt lieber am Schreibtisch oder in der Uni sitzen? Nein! Stop complaining then!
Wir erreichen das Bergdörfchen Soller ausgetrocknet und blasenreich. Das erste Café ist unseres und noch nie haben wir so schnell eine eiskalte Cola hinuntergestürzt. Wir sind heilfroh endlich angekommen zu sein. Morgen werden wir einen Pausentag einlegen, da sind wir uns einig. Ein bisschen weiter müssen wir aber noch, wir wollen noch ans Meer bis Port de Soller kommen. Aber dazu müssen wir glücklicherweise nur den Bus finden, der in der Stadt abfährt. Auf dem Weg hinunter finden wir endlich einen Trinkwasserbrunnen, um die Flaschen aufzufüllen. Ein netter alter Mallorqiner gestikuliert und will uns glaube ich zu verstehen geben, dass es sehr gutes Wasser ist. Er selbst füllt seine Kanister auf und knattert mit dem alten Golf davon. Wir laufen weiter, endlich vorbei an Orangen- und Zitronengärten. Ronja stibitzt die erste Frucht und ist glücklich. Wir sind im Sommer angekommen.
Dass wir den Morgen überlebt haben ist ein Wunder! Gegen die Zivilisation ist die Natur absolut friedvoll. Die Nacht im Gestrüpp, umgeben von Moskitos, Ziegen und möglicherweise Schlangen war harmlos im Gegensatz zur Rückfahrt hinunter nach Port de Pollença. Nachdem wir unsere Zeltwiese verlassen hatten wieder zur Straße aufgestiegen waren, wurde uns rasch klar, dass wir hier weit und breit die einzigen Seelen waren. Kaum ein Tourist würde sich um 7 Uhr früh aus seinem Hotelbett quälen, um statt der weichen Federn die harten Steine der Halbinsel zu betrachten. Wir liefen los, vor uns lagen gut 13km Asphalt, ein schmales Band Straße neben dem es für keinen Fußweg mehr gereicht hatte. Wir lauschten vor jeder Kurve, hoffnungsvoll, auf das Rauschen eines Motors, hörten lange nur den Wind. Dann kam die Psychotante… Eine Deutsche Mitvierzigerin, die mit diesem morgendlichen Trip ihrer penetranten Mutter zu entfliehen versuchte. Wir stiegen mit Englisch ein, aber nach dem ersten ‚th‘ war klar, auf welcher Sprache wir fortfahren konnten. Immerhin, sie hatte angehalten. Wir waren nicht wählerisch in Anbetracht der Alternative des Laufens. Als sie äußerte, dass sie lange nicht Auto gefahren war, bot ich ihr höflich, aber mit Nachdruck, mehrmals, an, das Steuer zu übernehmen. Sie schlug zu unserem Bedauern das Angebot aus und nahm die nächste Haarnadelkurve, schlingernd, auf der Gegenspur. Hoch konzentriert, sie verkrampft hinter dem Lenkrad, wir verkrampft in unseren Sitzen. Sie hätte Kreislauf, heute früh noch nichts gegessen, auch kein Kaffee, ob wir etwas zu essen hätten? Ronja und ich blicken uns an, ‚Hallo? Wir sind Backpacker…siehst du unsere Rucksäcke, wir haben kaum was dabei‘, Ronja bot dennoch aus reiner Menschlichkeit ihre Banane an, schließlich saßen wir in einem Boot. Auto. Sie würde nur ein Stück nehmen, sagte sie. Ronja, jetzt empört über so viel Dreistigkeit, todesmutig kühn, ‚also für ein Stück mach‘ ich jetzt nicht die ganze Banane auf‘. Ich hatte noch einen Müsliriegel, kramte diesen aus meinem Essenssack und trauere im Stillen um den unnötigen Verlust der Nahrung. Der Höllenritt nahm sein Ende in einer Seitenstraße Port de Pollenças, nachdem wir noch Zeuge ihrer Einparkkünste werden durften. Schnell weg hier! Als wir sie später im Supermarkt wiedersahen lief sie mit irrem Blick an uns vorbei. Echt, die Frau war nicht ganz dicht.
Es konnte nur besser werden. Frühstück am Strand, das war der Plan. Port de Pollença erwachte gerade erst, auf der Promenade rückten Restaurantbesitzer die Stühle zurecht, ein paar sommerlich bekleidete Touristen spazierten mit zeitungen und Brötchentüten am Wasser entlang. Eine Bank am Strand war wie für uns gemacht. Nachdem wir im seichten Wasser der Bucht abgetaucht waren und damit unser Waschdefizit beglichen hatten, standen alle Zeichen auf Kaffee. Nach der Entbehrung der Nacht und keinem wirklichen Abendessen musste nun ein Schokocroissant und ein Espresso her!
Wandern steht auf dem Programm. Wir wollten den Bus bis zum Enstieg des GR 221 nehmen, ein Weitwanderweg, der in Pollença etwas weiter im Inland liegen sollte. Wir warten 20min an einer lauten staubigen Hauptstraße, der Bus kommt, der Bus voll. Hat uns einfach stehengelassen. Was soll man machen: Daumen raus! Und prompt hält ein netter Mallorquiner vor unserer Nase und lässt uns einsteigen. Ein junger Mathelehrer, der selbst viel wandert und deshalb tatsächlich den Einstieg des GR221 kennt. Er fährt uns genau dorthin. Wir können unser Glück kaum fassen! Es geht los, Schilder weisen uns den Weg. Um die vier Stunden wanderten wir über waldige Wege zum Kloster Lluc in den Bergen.
Lluc hat ein Belohnungseis und -abendbrot für uns parat. Ein bisschen wundervoll ist Zivilisation eben doch. Da reichen schon drei, vier Stunden Abstinenz und man ist wieder froh mit Geld etwas kaufen zu können. Dann ist da nur doch die Frage nach einem Schlafplatz. Aber Ronja kennt die Gegend und weiß von geeigneten Plätzen im Wald, ein Stück weiter noch den Weg hinauf. Nachdem wir uns mit Cola, erfrischendem Salat und in Öl getränkten Scampis gestärkt haben, sind wir bereit noch ein knappes Stündchen zu laufen. Wir finden eine wunderbar weiche Moosplattform. Ich habe zwar Bedenken wegen Krabbelviechern, aber die habe ich ja immer. Und weil hier weit und breit kein antiseptischer Platz ohne Spinnen und Mücken aufzufinden ist, lassen wir uns nieder und ich plädiere für ein schnelles Auf- und Zumachen der Reißverschlüsse. Am Ende liegen wir sicher in unseren Schlafsäcken und lauschen den Ziegenherden, die raschelnd durch die Bäume klettern und über irgendeine Sache meckern.
Es scheint die Ziege in ihrer grasenden Routine nicht zu stören, dass wir im Auto dicht an ihr vorbeischneiden. Touristen gehen hier ein und aus wie die Ziegen. Sie sind Teil der Landschaft geworden, am Cap de Formentor. Eine lange Asphaltstraße schraubt sich Kurve für Kurve die felsigen Hügel hinauf, windet sich um schroffe Abhänge und endet schließlich ganz oben am Leuchtturm auf der erodierten Felsspitze des Kaps. Dank der späten Stunde sind die Massen bereits abgezogen. Nur eine Gruppe junger Spanier tummelt sich noch hier, schießt Selfies vom Sonnenuntergang in allen erdenklich Posen. Wir haben eine Mitfahrgelegenheit gefunden, unten am Kreisel in Port de Pollença. Es dauerte nicht lange, bevor ein Mietwagen am Straßenrand hielt und zwei Engländer uns in ihrem Auto willkommen hießen. Nennen wir sie William und Marc, ich habe die Namen vergessen. Backpackerschande über mein Haupt!
Mitte Mai 2017. Dieser Trip ist eine Auszeit von Zuhause, von dem Frühlingsregen und den Jackentemperaturen des deutschen Nordens. Wir fliegen aber nicht nach Malle wegen Sangria aus Eimern, auch wenn der Ryanair Partyflieger, den wir auf dem Hinweg erwischt haben, dies vermuten lässt (‚Allee, Allee – Allee, Allee, Allee – Eine Straße, viele Bäume, ja das ist eine…‘). Wir wollen fernab der Junggesellenabschiede und des Patytaumels in die Tramuntana abtauchen. Viel mehr: hinaufsteigen. Wildcampen. Wandern. NATUR NATUR – denn weder die knorrigen Olivenbäume, die märchenhaften Haine von Zitrusfrüchten noch die duftenden Aleppo-Kiefern interessiert die Schwimmprüfung, die Turnstunden und all das, was wir eigentlich gerade zu tun hätten in Kiel. Und so beschließen wir abzuschalten, auszuwandern, für fünf Tage mal ganz weg zu sein. Wie schon Gertrude Stein zu sagen pflegte: Wenn du das Paradies ertragen kannst, dann komm nach Mallorca. Wir sind in diesem Sinne mehr als leidensfähig!
Vom Flughafen bie Palma geht es mit dem Bus nach Alcudia – eine spontane Entscheidung, nachdem wir im Flieger nochmal die Karte studiert hatten. Wir hatten nicht wirklich einen Plan, wussten nur, dass es der westliche Teil des Eilands werden sollte. Das Cap de Formentor am nördlichen Ende der Insel versprach schon auf dem Papier Caspar David Friedrich-Steilküstenromantik mit Weitblick. Wie passend, dass das Land mal einem Dichter gehörte. Die Halbinsel wird hier auch Treffpunkt der Winde genannt, dieser Ort geformt von den Naturgewalten. Der Weg von Alcudia nach Port d’Alcudia und weiter Richtung Port de Pollença gestaltet sich nicht halb so romantisch. Zehn quälende Kilometer erst durchs Inland und schließlich entlang der Bucht von Pollença, eine Passage bei der es nur zwei Optionen gibt: die asphaltierte Straße oder ein algiger Strand. An uns vorbei rumpeln Laster und flitzen Rennradler, laufen tut hier eigentlich niemand. Ein hölzerner Campingtisch in einem kleinen Wäldchen am Wasser kurz vor Port de Pollença läd uns endlich zur ersten Mallorca-Backpacker-Jause ein. Abendsonne, sanfter Meereswind – hier sind wir Reisende, hier können wir sein. Als wir Port de Pollença hinter uns lassen halten wir am Kreisel zum Cap de Formentor den Daumen raus. William und Marc quetschen also wenig später unsere Rucksäcke in den kleinen Kofferraum des Mietwagens. Auf dem Rückweg vom Leuchtturm erspähen wir eine Wiese. Wir sind ganz sicher: für heute Nacht UNSERE Wiese. Wir steigen aus, mitten in den Serpentinen (Terpentinen, Ronja?), es ist schon ein bisschen schummrig geworden. Wir bedanken uns bei den Jungs, die uns etwas ungläubig anschauen (‚Do you really want to sleep out here?) und klettern weg von der Straße, durchs hohe Gras und über große felsige Brocken hinab. Die Wiese liegt in einer Senke und einem daran angrenzenden Plateau. Von Weitem sah das Gras kuschelig und weich und niedrig aus. Als wir davor stehen sind es, wie oben, Büschel aus hartem, langhalmigem Grün. Glücklichweise finden wir eine sandige Fläche dazwischen und sputen uns mit dem ersten Aufschlagen des Zeltes. This is real fucking adventure, hätte Kyle Dempster zugestimmt. Not polished, richtig im Gelände, wirklich keine Sau weit und breit und eigentlich dürften wir hier wohl auch nicht campen. Aber wir nutzen den off-season Vorteil. Und ich nutze Ronjas Furchtlosigkeit. Wie selbstverständlich beginnt sie die Sachen auszupacken, hat sich mit dem Schlafplatz schon arrangiert, während ich noch etwas skeptisch umherlinse. Horche. Gibt es hier Schlangen? Wildschweine? Böswillige Ziegen? Oder Monsterspinnen? Was könnte uns in der Dunkelheit auf diesem ausgesetzten Plateau ereilen? Ich muss an plötzliche flash floods denken, so eine wie die in der das Auto von Alexander Supertramp in Into The Wild geriet. Wir liegen in dieser Senke, was wenn es regnet und der trockene Boden das Wasser….Ronja putzt schon Zähne. Ich atme tief durch und versuche die freiheit die uns hier umgibt nicht weiter als bedrohlich zu empfinden, sondern als das Beste und Coolste was mir gerade passieren kann. Weit weg von Hotels, mobile reception und Verpflichtungen am Treffpunkt der Winde eine kostenlose Nacht verbringen zu dürfen – that is fucking real adventure and the greatest fortune imaginable. Buenas noches!
Ahoi und Servus liebe Jury,
wir sind Bentje aus Kiel und Karo aus München. Über den Weg gelaufen sind wir uns vor sieben Jahren während des Studiums im beschaulichen Passau. Bentje wollte Marathon laufen und Karo war dabei, eine Sportfreundschaft war geboren. Sieben Jahre später, nach gemeinsamen sportlichen Herausforderungen wie dem Hamburg Marathon, einigen Chiemsee und Wörthsee Triathlons, mehreren Ski- und Hüttentouren am Berg und einem sportlichen Roadtrip von New York nach Florida und zurück, machen wir nun Butter bei die Fische: Wir sind ready für das adidas Terrex Mountain Project!
Bentje ist seit Jahren vom Surffieber gepackt, ob auf dem Wellenreitbrett in Neuseeland, in Frankreich als Surflehrerin oder nach Feierabend kurz mal in Damp an der Ostsee unterwegs. Weil Kiel mit wenig Welle dienen kann, nimmt sie hier das Stand-Up Paddle Board und zum nächsten Fischbrötchen an der Förde wird seither noch geSUPt. Trotz norddeutscher Wurzeln kennt Bentje die Berge von Kindesbeinen an und möchte als erfahrene Läuferin endlich mal einen Fuß ins Trailrunning setzen. Karo sagt, das hätte sie schon längst mal tun sollen. Karo ist nicht zu halten, wenn es um und in die Berge geht. Ihre Leidenschaft für anstrengende Touren führt sie zu allen Jahreszeiten auf die Gipfel dieser Welt – in Trailrunningschuhen, auf Skiern oder in Wanderstiefeln. Als Spinning Trainerin bringt sie zudem das nötige Sitzfleisch für Radetappen mit. Bentje sagt, Karo muss aber unbedingt ‚meer’ aufs Wasser.
Wir sehen uns durch unsere 1000km Nord-Südgefälle viel zu selten, aber wenn, dann geht es sportlich her. Bentje, die Wasserratte und Karo, die Bergziege – wir bleiben unseren geographischen Heimatgefilden weitergehend sportlich treu, aber sind trotzdem unglaublich neugierig auf die Leidenschaften der Anderen. Das Adidas Terrex Mountain Project soll unsere Sportarten verbinden, daher wollen wir die Strecke vom Starnberger See aus zur Gartlhütte mit einem Mix aus ‚unseren’ Sportarten bewältigen. Das ist der Plan:
Tag 1: Durchquerung des Starnberger Sees (20 km) von Nord nach Süd mit SUPs, danach weiter mit dem Rennradl nach Garmisch.
Tag 2 & 3: Ab aufs Rennrad und Fahrt bis Welschnofen (204 km, 3300 hm)
Tag 4: Trailrun zur Kölner Hütte und über den Santnerpass Klettersteig zur Gartlhütte.
Berichten über die Höhen und – hoffentlich wenige – Tiefen des Projekts werden wir über Facebook und Bentjes Reiseblog ‚the Blogmopped’. Wir freuen uns, wenn ihr Nord und Süd, Fisch und Ziege wieder vereint und wir gemeinsam mit euer Unterstützung im Juli gen Gartlhütte paddeln, radeln, laufen und klettern können.
Und nun: Immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel! Berg Heil!
Wir freuen uns von euch zu hören.
Karo & Bentje


Vorwort
Manchmal denke ich ich könnte gut Kolumnen schreiben. Es passieren jede Woche wundersame Dinge über die es sich lohnt nachzudenken und zu berichten. Fast jeden Tag beobachte ich Menschen, werde Zeuge von Verwunderlichkeiten und Sonderbarem – hier direkt vor unseren Nasen im sogenannten schnöden Alltag. Direct snapshots of life is what makes a writer, hat einer aufgeschrieben, ich habe kein Talent dafür mir Autoren zu merken. Triviales erhebt sich aus der alltäglichen Beschränktheit, für kurze philosophische Momente mal anders sehen, das Kleine mit dem Großen verbinden, nachdenken, hinterfragen – und dann wieder zurück in den Status Quo gekuschelt, mit all seiner Trivialität d’accord, weil man weiß, dass es so ist, aber nicht sein müsste. Schlicht: sich kurz mal Gedanken machen tut gut, dann ist alles schon gar nicht mehr so staubig im Geschmack. Und sowieso weniger dramatisch. Philosophiert im Alltag! Raus aus Hamsterrädern! Ahoy ahoy!
Ich musste gestern mein Rennrad in seine Einzelteile zerlegen, um es in einem Transportkoffer unterbringen. Ich schlich seit Tagen um die monströse Box herum und drückte mich erfolgreich davor mein Fahrrad auseinanderzunehmen – aus Angst, es nicht wieder zusammenbauen zu können oder bei 30km/h auf dem Asphalt zu zerschelle, weil das Laufrad aus der Verankerung gleitet. Die Absurdität dieser Prokrastination ist mir nun, da das Fahrrad im Koffer längst auf Reisen gegangen ist und heute Nacht wohl friedlich in einem Paketzentrum schlummert, völlig bewusst. Die Furcht vor dem Zusammenschrauben und möglichen Sturz wird wohl bleiben bis ich, hoffentlich, eines Besseren belehrt werde.
Die Entstehung des Dilemmas? Unser jährlicher Triathlon steht an. Dieses Jahr sind Karo und ich am Wörthsee in Bayern im Einsatz. Ich muss also durch die gesamte bundesrepublik reisen, um 1500m zu schwimmen, 40km Rad zu fahren und 10km zu laufen. Vor zwei Monaten habe ich ein sensationell günstiges Bahnticket geschossen, 14 Euro, allerdings nicht bedacht, dass man im ICE keine Räder mitnehmen kann, nicht mal ein schlankes Rennrad. Überhaupt kein überdimensioniertes Gepäck wie Fahrradboxen. Also blieb mir nichts anderes übrig als das Rad zu schicken. Mit der DB, eigentlich albern, aber gut. Mein Rad reist mir nun also drei Tage voraus. Der Service ist komfortabel, von Haustür zu Haustür, geholt und gebracht. Trotzdem mehr als doppelt so teuer wie ich, 35 Euro, und dafür musste ich auch noch den nervenaufreibenden Preis des Auseinandernehmens zahlen…
…ich höre dabei alte Harry Potter Kassetten, die helfen mir daran zu glauben, dass alles gut wird. Die Stimme Rufus Becks ist beruhigend, sie verlangsamt mein panisches Gedankenchaos. Lord Voldemort wird besiegt und ich kriege alles abgeschraubt, ja ja. Die Kassetten, ihr surren und klicken im Rekorder, das braun flirrende Band, das sich manchmal aufrippelt und das man dann mit dem Finger wieder auffwickeln muss, selbst das Umdrehen der Kassette – sorglose Kindheit. Eine Kindheit, in der alle Bedürfnisse rund ums Fahrrad nur bei Papa anzumelden waren und schwups war alles gerichtet.
Ich würge mit dem Inbusschlüssel (wohlgemerkt: es heißt iNbus, nicht iMbus Schlüssel, das habe ich bis gestern nicht gewusst. Ist nämlich ein Akronym, INnensechskantschraube Bauer Und Schaurte → INBUS. Ich möchte an dieser Stelle zur Erweiterung des technischen Fachwissens aller ‚Unwissenden‘ beitragen.) an den Pedalen herum, eine bekomme ich abgeschraubt, die andere rührt sich nicht. Drei youtube Videos später gehe ich mit roher Gewalt ans Werk, ein youtube Reparateur sagt die fressen sich gerne fest. Achtung mit der Kette, da gibt es schnell fiese Schürfwunden wenn man abrutscht. Ich stelle mir vor wie ich mit dem Unterarm im Kettenblatt hänge und Blut sich mit Kettenöl vermischt. Ich laufe ein bisschen hilflos durch die Wohnung, räume hier und da etwas weg, habe eigentlich keine Lust mehr. Aber ich muss die Pedale abkriegen, verdammt. Ein kurzes angestrengtes Ächzen das klingt wie das Stöhnen der Tennisspieler beim Schlag, ein kräftiger Ruck am Inbusschlüssel und ein Gegentritt in die Pedale, und auch die zweite Pedale lockert sich. Endlich. Tzz, war ja leicht.
Man kann kein Rad auseinanderschrauben ohne dass einem gender Gedanken durch den Kopf sausen. Warum habe ich nie gelernt an Rädern rumzuschrauben? Warum habe ich Angst mir wehzutun? Warum steht mir diese eigentlich einfache Aufgabe so sehr bevor? Wäre Basti hier oder Papa, dann könnten die das ganz leicht machen. Überhaupt fallen mir eine Hand voll Männer ein, die sich damit sicher schon beschäftigt haben und die Benutzung des richtigen Werkzeuges aus dem Ärmel schütteln und nebenbei mit den Fachbegriffen der Fahrradteile joglieren. Wen dagegen könnte ich von meinen Mädels fragen? Da wird das Eis dünn, Leerlauf. Wir haben immer Männer gefragt. Wenn ich ehrlich bin hätte ich die Chance oft genug gehabt, Papa wollte mir im Fahrradkeller zu Hause in HH häufig zeigen wie man Räder repariert. Ich hatte ehrlich gesagt einfach keinen Bock. Ich wusste ja, dass er es doch macht. Dass er mir das durchgehen ließ erklärt auch einiges. Was, wenn ich ein Junge gewesen wäre? Mädchen werden nicht ‚gezwungen‘ zu lernen wie man Dinge repariert. Ihnen wird nicht vermittelt, dass man reparieren, auseinanderschrauben und ‚basteln‘ selber können ‚muss‘. Diese Dinge sind klar als männliche aufgabe definiert. Jungs wird vermittelt, dass sie diese Dinge lernen müssen. Irgendein männlicher Weggefährte nimmt sie zur Seite und sagt ‚ich zeig‘ dir jetzt mal was‘. Mädchen wird vermittelt: Wenn etwas kaputt ist was zur Reparatur handwerkliches geschick benötigt, etwas was gröbere Arbeit ist oder potentiell gefährlich sein kann – frag da lieber einen Mann. Der Großvater oder Vater, der Freund, ein Freund. Klare gender divide hier, die keinen umbringt, aber die Frau wieder in eine passive Rolle verweist. Das alte Spiel, in eine Position der Abhängigkeit verschiebt.
Das Rad ist verstaut, das Werkzeug zur Re-Montage ebenfalls. Räder, Pedalen, Sattel, Lenker – alles abmontiert. Ich bin ein bisschen sehr stolz als ich vor dem großen Hartschalenkoffer stehe, der nun meinen Renner in Einzelteilen enthält. Dabei will ich gar nicht stolz sein. Das soll gefälligst normal sein, gar kein großer Akt, mal eben schnell verpackt. Mich ärgert es, dass diese Radtransportgeschichte mich tagelang gedanklich beschäftigt hat. Im Endeffekt muss man nur machen, drangehen und ausprobieren. Geduld haben, Videos schauen und nachmachen. Trotzdem bin ich stolz. Und froh, dass es youtube gibt. Natürlich nur männliche Anleitung – beim Zusammenbauen werde ich ein Amateurvideo drehen und hochladen. Und dann ganz viel Ruhm und Geld mit einem Female Bike Repair Channel machen tataaa…bang, und dann waren alle gender Überlegungen wieder für die Katz, weil das ‚wir machen das jetzt für Frauen‘-Gehabe die Unterschiede doch nur wieder verstärkt. Warum muss es alles ‚für Frauen‘ und ‚von Frauen‘ geben was sonst in die männliche Domäne geschoben wird, ITkurse, Sportkurse, Technik- und Reparaturanleitungen – das bestärkt Schubladendenken. Das was Männerdomäne ist wird so nie weniger männlich werden. Es muss Fahrradreparaturvideos geben in denen Frauen und Männer agieren, ohne dass es extra betont wird. Erklärt ein Mann wie man ein Fahrrad verpackt wird sein Geschlecht ja auch nicht erwähnt. Genau die gleiche Geschichte wie mit den FußballkommentatorInnen. Selbst mir kommt es komisch vor wenn eine Frau ein Spiel kommentiert. Aber diese Irritation sollte uns aufschrecken lassen. Wie festgelegt wir sind! Wie unsere kulturelle Erziehung uns im Griff hat und unser Empfinden von Wahrheit und Richtigkeit dirigiert. Die erschaffene Natürlichkeit des Männlichen in unserer Gesellschaft ist das wirkungsvollste Instrument der Hegemonie – Dinge als ’normal‘ auszugeben und zu behandeln bedeutet (a) nicht zu hinterfragen und (b) alles Abweichende als unnormal, nicht standardmäßig, und so meistens als weniger wertvoll darzustellen.
Karo und ich wir werden uns am Sonntag bemühen aller Passivität eine gehörige Aktivität im Namen des Schwimmens, Radelns und Laufens entgegenzusetzen. Am Wörthsee. Startbeutelausgabe ist ab 6:30 Uhr. Na hoffentlich kriegen wir das mit dem Müsli und der Verdauung hin (waaas, Frauen haben Stuhlgang?). Es ist spät geworden. Die Harry Potter Kassetten beseitigen psychisches Chaos, ordnen aber nicht das physische Durcheinander in dieser Wohnung. Es klackt. Ich drehe die Kassette um. Weiter geht es. Harry geht wahrsagen, ich staubsaugen.
„The mountains are calling,
and I must go.“
(John Muir)
Wir setzen keine Segel, wenn der Wind aus Ost in die See mit selbem Namen schwatzt. Keine Drachen steigen aus unseren Händen gen Himmel. Und doch ziehen wir uns das Seehundfell über die Ohren, ein Brett, eine Leash – puristisch. Feierabenteuerisch berauscht den Kopf ins salzige Nass getaucht, Windwellen kreuzen quer und rollen. Und inmitten dieses Chaos gluckernde Glückskinder, die Haarsträhnen aus Gesichtern streifen und der nächsten Woge nacheifern. Mittendrin hinausgerissen, im Meer ist nie Alltag – und doch so nah, nur ein kurzer Ausflug aus dem Montag Nachmittag.
Neulich ließ mir jemand einen Zeitungsartikel zukommen. Dieser Jemand aus der nahen Verwandtschaft wollte sich entweder lustig machen oder war neidisch, oder vielleicht beides. Laut des Artikels jedenfalls ist die Küche das neue Statussymbol der Deutschen. Vor allem der gerade erwachsengewordenen Generation, oder noch im Werden begriffen, jedenfalls die so um die Dreißig. Abendeinladungen seien, so die Überschrift, keine „ausgelassenen Feste“ mehr, die jungen Leute heute treffen sich „in stylischen Wohnküchen und kochen bis zum Umfallen“. Ich fühlte mich ertappt, als hätte jemand die vergangenen Wochen während des Umzugs in unsere Küche geluschert und Stück für Stück die Edelstücke einziehen sehen – die Miele Waschmaschine und Geschirrspülmaschine, die La Pavoni Espressomaschine und ein empire-rotes Dreigestirn aus Artisan Küchenmaschine, Artisan Standmixer und Multifunktionstoaster, natürlich, von Kitchen Aid. Mir sind ausgedehnte Kochsessions mit Edelprodukten durchaus nicht unbekannt, die „Kochtöpfe von Le Creuset“ (dabei sind die von Staub doch viel schöner, wegen der zarteren Griffe) kein lifestyle Märchen. Gerade vorgestern wurde das „selbstgemachte Bio-Pesto im teuren Standmixer zubereitet“. Manchmal ein bisschen ‚drüber‘, mag sein. Die ausrangierten Kochtöpfe von Oma hätten es sicher auch noch getan, ein stumpfes Messer macht zwar keinen Spaß, aber immerhin stirbt auch keiner daran. Und einen Rührdiener brauche ich eigentlich auch nicht. Zumal ich mir als Studentin sehr schlecht vorkomme so ‚unstudentisch‘ edel zu residieren. Ich kümmere mich immerhin um den Kräutergarten! Trotzdem, was soll man lügen – es ist einfach schön, schmeckt und tut der Seele gut. Die Living at Home würde sich bei uns im Küchenstudio mit hellem Pitch Pine Holzboden wie zu Hause fühlen. So eine Kücheninsel, das wäre es ja noch, die ist immerhin laut Artikel „der Porsche in der Welt der Küchen“. Wir arbeiten dran. Bis dahin: hashtag foodporn, hashtag Markensau, hashtag richtig geil, hashtag Lääkaa!
PS: Den Artikel gibt es leider nicht online und mir wurde noch keine „Quelle“ mitgeteilt.
 Ich parke das Auto auf dem Schotterparkplatz am Leuchtturm. Für gewöhnlich ist der Platz dicht mit VW Bussen und Wohnmobilen, denn im Sommer sucht man als KielerIn hier Auszeit vom Alltag. So nah und doch so fern sein, für einen Grillend, eine Campingnacht, einen ’skinny dip‘ in der Ostsee am nächsten Morgen – den Kopf freimachen, abkühlen bevor es wieder an die Uni oder in den Job geht. ‚Strandistan‘ statt Balkonien. In zwei, drei Monaten wird es wieder soweit sein. Aber heute stehe ich fast alleine hier, der Kies knirscht unter den Rädern und als der Motor verstummt dringen nur Möwengeschrei und Windesrauschen durch die Scheiben. Die Parkuhr verlangt noch kein Geld: März bis Oktober. Nebensaison. Es ist erst 9:30 Uhr, an einem Dienstag. Eines der Privilegien im Studium ist die flexible Zeiteinteilung, eine Kondition die, ganz nebenbei, Alltag sein muss für Poeten und Naturliebhaber. Ich konnte heute morgen keinen Fuß unter dem Schreibtisch still halten, der erste Sonnenstrahl, der auf meine Hausarbeitsunterlagen fiel ließ mich diese wieder zuklappen.
Ich parke das Auto auf dem Schotterparkplatz am Leuchtturm. Für gewöhnlich ist der Platz dicht mit VW Bussen und Wohnmobilen, denn im Sommer sucht man als KielerIn hier Auszeit vom Alltag. So nah und doch so fern sein, für einen Grillend, eine Campingnacht, einen ’skinny dip‘ in der Ostsee am nächsten Morgen – den Kopf freimachen, abkühlen bevor es wieder an die Uni oder in den Job geht. ‚Strandistan‘ statt Balkonien. In zwei, drei Monaten wird es wieder soweit sein. Aber heute stehe ich fast alleine hier, der Kies knirscht unter den Rädern und als der Motor verstummt dringen nur Möwengeschrei und Windesrauschen durch die Scheiben. Die Parkuhr verlangt noch kein Geld: März bis Oktober. Nebensaison. Es ist erst 9:30 Uhr, an einem Dienstag. Eines der Privilegien im Studium ist die flexible Zeiteinteilung, eine Kondition die, ganz nebenbei, Alltag sein muss für Poeten und Naturliebhaber. Ich konnte heute morgen keinen Fuß unter dem Schreibtisch still halten, der erste Sonnenstrahl, der auf meine Hausarbeitsunterlagen fiel ließ mich diese wieder zuklappen.
Nach Wochen des Regens beginnt ein Tag wieder ohne Wolken. Es hat gefroren in der Nacht und die Landschaft liegt noch in Winterstarre. Meine Laufschuhe klingen auf dem harten Boden tap tap im Rhythmus. Pferdehufe haben sich im Waldboden abgedrückt. Eine leichte Dünung schlägt an der Strand, mein tap tap und das Rauschen von Wind und Welle begleiten meinen wolkigen gleichmäßigen Atem. Obwohl noch kein Baum ein Blatt trägt unterhalten sich die Vögel schon lautstark über den Frühling. Der Protagonist in einem meiner Uniromane kletterte gestern Abend in das Gemälde eines englischen Landschaftsmalers, heute bin ich bei C.D. Friedrich eingestiegen. Ein Gemälde betreten, so fühlt sich dieser Morgen an. Der Weg verläuft parallel zum Strand, etwas erhoben, dann führt sandiger Boden auf die Höhe des Strandes, rechts sanfte Dünen, links tut sich ein weites Feld auf. In der Ferne liegt eine kleine Siedlung von drei Gebäuden, Scheunen und ein Landhaus. Das Feld grenzt an die Steilküste und ich erklimme den Feldweg, der am Rand der Küste entlangführt. Hier hat die Sonne den Boden schon aufgeweicht. Ich glitsche auf dem Matsch hin und her, verfalle schließlich in ein Spaziertempo. Ganz entfernt ein Reiter am Strand, mit Hund. Ich war lange nicht hier draußen, zu lange dafür, dass ich merke wie sehr dieser Ort Kiel für mich lebenswert macht. Hier ist das Wasser, an dem ich immer leben wollte.
Auf dem Rückweg begegne ich ein paar mehr Menschen, ältere Paare die wie ich an einem Dienstag vormittag an keine Pflicht gebunden sind. Wir begrüßen uns mit einem Zunicken, einem leisen ‚moin‘ und ziehen weiter unseres Weges. Wir sind verbündet in der Schönheit dieses Morgens, Februarspazierende im Sonnenschein. Ein Fischer steht in langen Hosen an der Ecke des Leuchtturmes im Wasser und kurbelt an seiner Angel, zwei Männer tragen vom Parkplatz ein kleines Boot ins Wasser. Die Sonne wärmt inzwischen durch meine schwarze Laufhose. Ich freue mich auf den Sommer. aber eigentlich komme ich am liebsten hierher, wenn der Strand noch still ist. Wenn der Parkautomat noch keine Münzen schluckt. Winterherrliche Nebensaison.
Nächste Kieler Flucht: Das Sportzentrum der CAU (2)
Mein Budget ist höchst gefährdet! Da denkt man der Backpack limitiert das Shopping, das studentische Budget begrenzt die Luxusausgaben und dann steht man doch vor den Regalen und kann nicht anders. Zumal es Auswege aus diesen Grenzen gibt: Franzi kann theoretisch etwas von mir mitnehmen und mein Konto ist zwar schon leerer als am Anfang, durch die vielen Couchsurfing, Wwoofing und Housesitting Nächte jedoch noch nicht so strapaziert wie erwartet. Das stockt das Budget für das ein oder andere stoffliche Mitbringsel auf. In Amerika nicht dem Kapitalismus zu fröhnen wäre zudem völlig unauthentisch, das geht nicht auf diesem kulturellen Erfahrungstrip. Also rein in die Shoppingcenterhölle! Es stellt sich heraus, dass Franzi meine Glücksfee ist – dabei wollte SIE doch einkaufen und ich nur beratend beistehen. Ich packe am letzten Tag persönlich ihren Rucksack, damit auch ja alles reinpasst.
4 Tage San Francisco. Zwei Nächte dürfen wir nochmal bei Anton und Lena auf der couch pennen, die anderen beiden Nächte haben wir ein Hostel. DAS Hostel, direkt am Fort Mason, das beste Hostel der Welt. Seit ich 2013 das erste Mal hier und danach hin und weg war (https://blogmopped.com/2013/02/23/the-left-coast/), gab es keine andere Möglichkeit als wieder herzukommen. Franzi und ich haben die letzten zwei Betten ergattert, in der Hauptsaison ein relativ stolzer Preis für ein Hostel. Aber das ist es wert. Eine Übernachtung im 22 Bett-Zimmer ist immer eine Erfahrung. Gegen zwei Uhr trampelt jemand in den Schlafsaal, erklimmt unter Stirnlampenlichtgewitter direkt ‚in my face‘ ächzend das Hochbett über mir und ich habe Angst, dass gleich alles zusammenstürzt. Der Opa neben Franzi pupst und röchelt abwechselnd. Vorm zu Bett gehen hat er uns seinen hautfarbenen Schlüpper und nackten Oberkörper präsentiert. Aber irgendwie ist er süß und wir fragen uns was er hier tut. Hat er kein Geld für ein privates Zimmer? Warum ist er alleine in San Franzisco? Anton hat von einem Hostelerlebnis berichtet bei dem ein älterer Mann eine Operation vor sich hatte, deshalb ein günstiges Zimmer nehmen musste, er hatte kaum genug Geld für die Operation. Wir überlegen, ob unserem Opa auch so etwas bevorsteht. AM nächsten Abend aber lernen wir, dass er durchaus genug Kohle hätte für ein eigenes Zimmer – ihm gefällt die Hostelatmosphäre. Und nicht ein Krankenhausbesuch hat ihn hierher verschlagen, sonder ganz simpel die Stadt selbst, ein jährlicher Besuch in San Francisco, Tradition.
Wir nehmen alles mit, ohne zu sehr den Touri zu mimen, lassen wir uns treiben und kommen doch an alles Ikonen der Stadt vorbei. Chinatown, die bunten Häuser, die Waterfront mit ihren Seehunden und gift-shops, natürlich ein, zwei rides in der cable car. Nach einem langen Shoppingtag im Nordstrom Einkaufszentrum und dem Nordstrom Outlet etwas außerhalb hat selbst Franzi als exzentrische Nordstromanhängerin genug und einfach nur noch Hunger. Ein kleiner Park auf einem der höchsten Hügel der Stadt ist unsere kleines Geheimnis, ein Kleinod, wir entdecken ihn auf dem Weg zur berühmten Lombard Street. Asia take away food muffelnd sitzen wir in der Sonne, freier Blick auf die Golden Gate Bridge, ich ziehe Schuhe und Jacke aus, der Spätsommer bündelt seine letzten kräftigen Strahlen auf unserer Bank. Am Abend treffen wir nochmal Lena und Anton, downtown, in einer kleinen Jazzbar. Wir kaufen ein paar Dosen Bier, sitzen am Fenster und unterhalten uns soweit es die Musik zulässt, zwischendrin wird geklatscht für die Musiker. Nur drei, vier kleine Tische sind besetzt. In der Bar wird Käsefondue angeboten, Neben uns sitzen drei junge Leute, die irgendwann einfach aufstehen, zahlen und gehen. Auf ihrem Tisch bleibt ein unangetastetes Fondue zurück, gefüllter Brotkorb, Weintrauben, eine Schale randvoll mit flüssigem Käse. Anton hat Hunger und handelt: Können wir das vielleicht aufessen?, fragt er die Bedienung. Sie schaut etwas verdutzt, aber nickt dann und sagt sie habe nichts dagegen. Es wäre doch gut, wenn nicht so viel übrig bleibt und weggeschmissen wird. Anton wechselt den Platz, grinst und winkt uns hinüber. Wir zögern kurz, irgendwie komisch, sollen wir wirklich…wir folgen ihm und zwei Minuten später schieben wir uns fettige Brotstücke in die hungrigen Mäuler. Die Leute um uns herum schauen erst komisch, haben aber bald vergessen, dass dieser Tisch nicht von Anfang an der unsere war. Eine Quittung auf dem Tisch zeigt die Summe US$140, so ein Abendessen kann man sich mal gönnen, for free. Schnäppchen. Sehr sehr geil, Anton! Dazu noch der Rest Weißwein unserer unwissenden Gönner und wir fahren selig zurück ins 22-Bett-Zimmer. Luxuriöser Budgettrip!
Dann ist irgendwie auch schon der letzte Tag da und Franzi packt ihren Koffer, also ich packe ihren Rucksack, wie gesagt…für mich ist es erst später Zeit aufzubrechen. Ich winke ihr zum Abschied und bin wieder alleine, jetzt muss ich erstmal wieder umschalten. Der Nachmittag ist regnerisch und windig, eine gute Gelegenheit die alte second hand Buchhandlung im Fort Mason nocheinmal aufzusuchen, auch die kenne ich von vor 2 Jahren. In dem alten Militärgebäude stehen Regal voll gebrauchter Bücher und an den Raum ist ein kleines Cafe angeschlossen – alles was ich brauche. Ich verbringe hier einige Stunden bis es Zeit wird auch meinen Rucksack zu schultern. Ich bin auch wieder im Sparmodus, keine weitere Nacht im Hostel, mein Flieger nach Norfolk, VA geht ohnehin schon mittags am nächsten Tag. Der airport shuttle holt mich um 22 Uhr ab, ich werde mit dem Boden des Flughafens vorlieb nehmen. Der ist umsonst und außerdem lässt es sich auf Flughäfen ganz wunderbar Menschen beobachten. Good night San Francisco, good bye beautiful city am Pazifik. Es war mal wieder ein bisschen wie im Märchen.
Wir sind froh diesen Morgen zu erleben. Fast ist der festen Überzeugung, dass wir in der Nacht im Auto fast erstickt wären. Wirklich viel Sauerstoff konnten wir aus der Luft nicht mehr herausfiltern, so erklärt sich auch das allgemeine Röcheln. Dementsprechend unentspannt war die Nacht, keine von uns fühlt sich am Morgen sonderlich ausgeruht. Da kann nur ein gutes Frühstück helfen! Wir packen zusammen, heute geht es zurück nach Seattle und so rollen wir an alle Matten und Schlafsäcke zusammen, packen die Rucksäcke und klappen alle Sitze wieder hoch – der Autoverleih wird keine Spur davon finden, dass wir dieses Auto kurzerhand in einen Campervan umgewandelt haben. Der Vormieter unseres Platzes hat mit Krebspanzern den Namen seiner oder seiner Geliebten gelegt, ALEX steht in großen Lettern auf dem Waldboden, daher rührt also der penetrante Fischgeruch. Weg hier! Wir fahren ein paar Meilen den Highway 101 entlang und finden bald ein richtig amerikanisches roadside Restaurant, ‚family diner‘ steht in Leuchtschrift im Fenster. Rein da, wir brauchen Pancakes, Hashbrowns, Bacon und French Toast! Mama macht sich Sorgen um unsere Linie als wir ihr Bilder unseres ausgiebigen Frühstücks schicken, aber auch hier gilt wieder die kulturelle Erfahrung. Immerhin ist es schon 11 Uhr, das gehaltvolle Frühstück ist so auch gleich Mittagessen. Mit uns sitzen ‚typische Amerikaner‘ im Raum, wenn ich mich hier mal wieder in der Vorurteil- und Stereotypenkiste bedienen darf. In Jogger und Latschen, mit krampfadrigen weißen Käulenwaden und Burgern oder Sandwiches auf dem Teller. Statt Salat häuft sich ein Berg Salt and Vinegar Chips als Beilage auf dem Teller. Herrlich. Mein Kaffee geht nie zur Neige, refill bis ich hyperventiliere. Wir kugeln ins Auto. Eineinhalb Stunden brauchen wir danach bis Olympia, einmal schnell in den Trader Joe’s Supermarkt, ein Nobel-Aldi, den ich Franzi zeigen will. Die ist Abgelenkt, weil es freies Wifi gibt, immer diese Internetoasen! Kurz zum Superoutdoorstore REI rein, dann weiter eineinhalb Stunden bis Seattle. Die Sonne begleitet uns auf dem ganzen Weg zurück. Wir laden das Gepäck bei unseren Housesitter Eltern ab, die Mishka und McDuffy bellen und schlecken uns ein großartiges Willkommen. Das ist wie nach Hause kommen. Downtown geben wir das Auto zurück, so schnell wie wir es bekommen haben sind wir es auch schon wieder los, kopfschüttelnd schauen wir uns an: Wir sind doch gerade erst losgefahren. John, Anica und Elizabeth laden uns zum Essen ein, John bestellt wird drauf los und bald biegt sich der Tisch unter italienischen Köstlichkeiten. Wir teilen alles, probieren uns durch diverse Gerichte – Focaccia Brot, meatballs, Salamipizza, zum Abschluss ein krönendes dunkelschokoladiges Eis und cremiges Tiramisu. Wir sind so dankbar, auch dafür, dass die drei uns noch eine weitere Nacht bei ihnen schlafen lassen. Eine entspanntere Zeit hätten wir in Seattle kaum haben können. Alle sind glücklich, alles wunderbar. Franzi und ich führen Mishka und Duffy auf einen letzten nächtlichen Spaziergang aus. Morgen geht es weiter, um 9:30 Uhr werden wir in den Coast starlight Zug nach San Francisco steigen. Dann heißt es Good-bye Seattle und ‚Keep in touch!‘ mit unser Seattle-Family. Thank you, Anica, Elizabeth, John, Mishka and McDuffy.





Beim Anblick von Tatoosh Island regen sich in mir wieder die Leuchtturmwärter Fantasien. Ein Writer-in-residence Programm, ein Leuchtturmschreiber, a lighthouse poet. Sowas braucht eine Küstenstadt doch, Kiel zum Beispiel! Es gibt Inselschreiber und Stadtschreiber, aber soweit ich weiß schreibt bisher niemand in einem alten Leuchtturm. Und dieser, dort draußen auf Tatoosh Island, wäre kaum zu überbieten. In Sturmnächten peitscht die Flut gegen die Steilküste, Neblnächte und Sonnentage. Nur die Strömungen machen mir etwas Sorgen, ich frage mich, ob es sich auf einem kleinen Boot einfach so hinausschippern ließe. Die Wasseroberfläche ist unruhig, kleine Strudel zeichnen sich ab, hier fließt es in eine andere Richtung als dort. Bewegtes, wildes Wasser, hier draußen, am letzten nordwestlichen Zipfel der USA, land’s end. Piratig!
Nach einer unruhigen und kalten Nacht liege ich um 6:00 Uhr wach. Seite, Rücken, Bauch – Liegen ist schlicht nicht mehr möglich. Ich bin zwar alles andere als ausgeschlafen, aber das hier ist kein Zustand. Während Franzi und der gesamte Campingplatz noch schlafen krame ich leise meine Laufsachen aus dem Rucksack auf dem Vordersitz. Ein Langarmshirt für den Anfang, es fröstelt mich. Noch hängt Nebel in den Hügeln, aber zwischen den Tannen im Hinterland blitzt ein erstes goldenes Licht hervor. Ich falle in einen lockeren Trab, wecke die Muskeln behutsam auf. Durch den tiefen Sand, dann fester Grund nahe der Wasserlinie. Der Strand ist breit, die Gezeit kann nicht weit vom Tiefstand entfernt sein, doch das Wasser scheint schon wieder aufzulaufen, ab und zu rollte eine kleine Welle durch einen prielartigen Wasserlauf am Strand. Große Fischgräten liegen am Boden verteilt, die Möwen sind schon wach. Am Nordende des Strandes fängt sich das erste Sonnenlicht in den Pinien, die auf einem steilen Felsen über dem Meer wachsen. Nach 15 Minuten versperrt mir ein aus dem Inland kommender, nach Schwefel riechender creek den Weg. Alles ist an diesem Ende des Strandes nun in Sonne getaucht. Ich drehe um und laufe dichter ans Wasser. Vom Campground steigen Rauchschwaden auf, es riecht nach Feuer und ich habe Skiurlaubsassoziationen. Der vordere teil des Strandes ist zu einer kleinen Halbinsel geworden, ich muss Anlauf nehmen und über den Wasserlauf springen, der mich wie ein Burggraben vom Campground abschneidet. Danach habe ich ein bisschen nasse Patschen. Zum Glück gibt es hier eine Dusche mit heißem Wasser, purer Luxus! Franzi ist inzwischen auch so halb wach, gönnt sich für die andere Hälfte ebenfalls eine Dusche, Um 9 Uhr schichten wir die Rucksäcke um, klappen die Sitze in die richtige Position und rollen los. Erster Stop heute Morgen also: der Cape Flattery Trail. Eine halbe Meile folgen wir einem Pfad durch dschungelartige Vegetation, dann lichtet sich das Dickicht und gibt den Blick auf gewaltige ausgewaschene Felsformationen frei, Wellen, die in Höhlen krachen, manchmal kann man die Erschütterung im Untergrund fühlen. Ganz am Ende des Trails kommt Tatoosh Island in Sicht, dahinter liegt nur der Horizont, nach Westen, im Norden zeichnen sich die Schemen von Vancouver Island ab. Kanada, so unglaublich nah, irgendwie ist das verrückt. Gerade ist wieder jemand durch die Strait of San Juan de Fuca geschwommen, das lese ich später in einer Zeitung.
Zeit für Frühstück. In Neah Bay suchen wir uns ein ruhiges Plätzchen am Wasser. Ruhig ist es hier sowieso überall, als läge hier der Hund begraben. Allerdings darf ich damit jetzt gerade nicht scherzen. Franzi kriegt schon wieder die Krise, weil drei kleine Hunde ohne erkennbaren Besitzer rumlaufen. Über die Straße, dicht an den großen Chevy Trucks vorbei, ein bisschen schmuddelig sehen sie Hunde schon aus, aber nicht so als würden sie Hunger leiden. Ich versuche zu vermitteln, vielleicht hat man hier einfach ein anderes Verständnis von Tierhaltung, die laufen hier eben frei rum. Aber Franzi kann das nicht ab und tigert los die Hunde zu finden und jemanden, der für sie verantwortlich ist. Ohne Erfolg. Wir machen uns auf den Weg, weiter geht es den Highway 101 entlang, heute wollen wir noch etwas Strecke machen, denn morgen nachmittag müssen wir schon wieder in Seattle sein. die Campgroundsuche am Abend braucht drei Anläufe, die ersten zwei Nächte hatten wir definitv die besten locations. Jetzt steht nur noch Waldcamping zur Auswahl. Das labour day Wochenende ist vorüber und so sind wir in dieser letzten Nacht fast alleine auf dem Platz. Beim bezahlen treffen wir allerdings ein niedliches älteres paar aus Huntington Beach, das mit ihrem riesigen RV unterwegs ist – an dem hängt hinten selbstverständlich noch ein Auto! Zum Abendbrot beobachten wir im Abendrot eine robbe, die im Fluss immer wieder auf und abtauch und-schnauft. Sonst ist es ganz still. zu unserem Entzücken zeigt sich in diesem klaren Abendhimmel auch noch ein lang ersehnter Freund: Mt. Rainier erhebt sich am Horizont, seine weiße Schneekappe ist gut zu sehen. Jetzt sind wir zufrieden, jetzt haben wir wirklich fast alles gesehen. Dann können wir jetzt auch schlafen gehen. Night night.
Bild: Auf der anderen Seite der Strait of San Juan de Fuca liegt Kanada, Vancouver Island.
Stephenie Meyer wird in Forks verehrt wie eine Heilige. Mit den Twilight Büchern machte sie den regnerischsten Ort der USA, ein trostloses düsteres Städtchen namens Forks, weltweit bekannt. Weil sich hier selten die Sonne zeigt fühlen sich Vampire hier besonders wohl, in ihrer Geschichte zumindest. Als wir die Ortsgrenze überqueren ist jedoch kein Wölkchen in Sicht. Ich hatte keine Ahnung was es mit Forks auf sich hat, aber Franzi wird ganz hibbelig je näher wir der Stadtgrenze kommen. Ich lasse mir im Auto kurz nochmal die Geschichte von Twilight zusammenfassen. Edward, Bella, Jacob. Vampire gegen Werwölfe, dazwischen die Menschen. Ein bisschen Romeo und Julia Liebesgeschichte: sie wollen sich, sie dürfen nicht. Alles klar, auf gehts. Wir sind vom South Beach Campground aufgebrochen, haben an der nächsten Tankstelle Kaffee getankt und auf der Heckklappe des Autos bagels mit Cream Cheese gefrühstückt. Es hat die ganze Nacht heftig geregnet. Wir sind mehr als froh das Auto zu haben. Die erste Nacht in unserem improvisierten Campervan haben wir erfolgreich überstanden, leichte Rückenschmerzen singen wir zum Aufwachen mit „atemlos durch die Nacht, weil die uftmatratze flacht“ weg…Nach dem Frühstück geht es also nach Forks. Hier bombardiert uns das Visitor Center mit der ersten Ladung Twilight: Der alte Truck von Bella steht vor dem Gebäude, Pappfiguren von Robert „Er ist soooo hot“ Pattinson alias Edward „Er ist soooo kalt (und blass, aber hot)“ Cullen und all den anderen. Es werden Vampirtouren für $60 aufwärts angeboten, Tshirts mit Biss und Bildbände mit Fotos der Drehorte. Mitte September feiert Folks „one decade of twilight“, wie blöd, dass wir da schon in San Francisco sind. NOT. Kurzes shopping im Supermarkt, ein bisschen Knoblauch kaufen (…), dann schwingen wir uns wieder in die Karre und auf geht es zum Twilight Hotspot Nummer 2: La Push. Klingt unglaublich dumm, heißt aber so. Ein Strand an der Küste, etwa 12 Meilen von Forks nach Westen. Bei der Anfahrt die Küstenstraße hinunter spotte ich Surfer! Viel cooler als Vampire, ihre Körpertemperatur kühlt der Pazifik aber mindestens so stark runter wie bei den Blutsaugern. Nur die Neos, Kappen und Booties verhindern die Blässe. Wir wandern ein bisschen am Strand herum, Franzi findet die Bucht, eingerahmt von steilen, pinienbewachsenen Felsen sehr akkurat beschrieben. Sie kann sich Bella und Edward hier vorstellen. Die Sonne scheint, aber warm ist es nicht gerade. Lange Hose und Windjacke sind Programm.
Es ist 15 Uhr und unsere Mägen knurren wie wütende Werwölfe. Ein kurzer Klobesuch in La Push bringt uns einen Restauranttipp ein. Weil mein Schloss klemmt und ich nicht mehr aus der Toilette rauskomme rettet mich der Hausmeister der Ferienanlage. Während Franzi die restrooms benutzt komme ich mit, nennen wir ihn James, also mit James, ins Gespräch. Er fragt, ob wir aus Deutschland kommen, er hat uns reden gehört. Er fragt in einem fast perfekten Deutsch! Ich bin kurz sprachlos, warum, wieso? Er ist beim Militär, war drei Jahre in Bamberg stationiert, hat einen siebenmonatigen Deutschkurs belegt. Wir quatschen ein Viertelstündchen, er erzählt uns noch einen Witz über Katholiken („Im Dorfteich planschen nackt ein katholischer Junge und ein protestantisches Mädchen. Beim Abtrocknen sagt der Junge: „Da sieht man mal, was euch Protestanten so alles fehlt…“) und empfiehlt und dann das „Three Rivers“ Restaurant an einer Weggabelung in Richtung Forks. Bingo, da gibt es gleich mal den Werwolf-Burger. Und Onion Rings! Und Oreo Michshake! „Jetzt bin ich in Amerika angekommen“, strahlt Franzi, „kannst du das Fett brutzeln hören?“. Wir sitzen hier eine Weile, Telefonempfang gibt es hier nicht, aber Wifi. Und das Twilight Hörbuch muss eh noch laden. Selbstlos helfe ich Franzi den Oreo Shake zu bewältigen. Dann brechen wir auf, ein bisschen müssen wir noch fahren. Vorbei an Neah Bay an der Nordküste, dann schwenkt der Highway wieder nach Westen, zurück an die Westküste! Franzi hat auf dem Weg einen streunenden Hund auf der Straße gesehen und ist ein bisschen durcheinander, sowas kann sie nicht ab, sie möchte gerne alle Hunde retten. Schließlich finden wir den Hobuck Campground, wie South Beach wunderschön gelegen, direkt am Strand. Auch hier beobachten wir Surfer bis das letzte Licht des Tages hinter den Pinien verschwindet. Und ein Hundi läuft am Strand herum, kommt zu uns und Franzi ist glücklich, dass sie ein bisschen Fell streicheln kann. 9 pm, höchste Zeit, wieder in unsere Autohöhle zu kriechen. Autocamper sind früh im Bett und früh wach, gute Nacht!
Unsere Housesitter hosts Anica, Elizabeth und John fahren uns um 8:15 gemeinsam zur Light Rail Station in Columbia City. Ein an Herzlichkeit kaum zu übertreffendes Abschiedskommitee, und das so früh am Morgen, dabei steht die neunjährige Anica am liebsten erst um 10 Uhr auf. Wir fühlen uns sehr geehrt. Zum Glück sehen wir uns in 4 Tagen nochmal wieder. Franzi und ich sind auf Mission Mietwagen unterwegs: Ein Roadtrip liegt vor uns. Wir wollen von Seattle südlich fahren, nach Olympia und dann nach Westen auf den Highway 101, der uns an die Küste führt. Den Olympic National Park zu umrunden ist unser Ziel. Über Kalaloch und Forks ganz hoch zum nordwestlichsten Zipfel der USA, Cape Flattery, und dann entlang der Strait of San Juan de Fuca, Kanada im Blick, östliche Richtung einschlagen, anschließend wieder Kurs auf Olympia im Süden nehmen. Wir haben außer dieses groben Plans keinen festen Zeitplan, wir schauen mal was kommt. Mehr als eine Straße gibt es dort oben ohnehin nicht, dafür soll es aber ausreichend Campingplätze geben. Am Schalter von Alamo in downtown Seattle sind wir ruckzuck temporäre Besitzer eines schicken Mazda 3 – der sieht viel nobler aus als erwartet, ich hatte eigentlich einfach das günstigste Auto gebucht. Wagemutig leihen wir kein Navi, wenn es hart auf hart kommt und die Straßenschilder versagen, dann habe ich zur Not noch mein google maps. Als moderner Abenteurer muss man sich ja technisch absichern! Los geht es, endlich wieder Räder unter den Füßen. Es dauert nicht lange bis wir das Labyrinth der Innenstadtstraßen hinter uns lassen, denn bald taucht ein grünes Schild mit I5 South auf. Jetzt wird der Country Sender im Radio gesucht und dann bin ich wirklich angekommen. Wir gleiten über die vierspurige Autobahn, von rechts und links überholen Autos, hier gibt es kein Rechtsfahrgebot, aber alles scheint mir erstaunlich geregelt, im Fluss. Vielleicht ist es auch unsere Vorfreude auf die kommenden Tage, die uns alles sonnig und easy sehen lässt. Peace, Happiness, Eggcake, wir grinsen wie Honey Cake Horses. Nach eineinhalb Stunden drückt die Blase. Franzi hat im USA Fettnäpfchen Buch gelesen, dass Pinkeln am Straßenrand strafbar ist. Wir riskieren den Knast und halten an einer Waldeinfahrt. Als Franzi wieder einsteigt bläst die Fußlüftung einen unangenehmen Geruch durch den Raum … an den Schuhen klebt, ja was, Elchscheiße? Wir können es nicht genau identifizieren, aber die Schuhe werden sofort in eine Plastiktüte verpackt und ins Kofferraumexil verbannt. Weiter geht es den Highway entlang, die gelbe Linie in der Mitte der Straße schlängelt sich als unser ständiger Begleiter neben uns her. Die Vegetation ist dichter Wald, mal überblicken wir große Ebenen und Hügel in der Ferne, mal fahren wir in einer Schneise, am Straßenrand gigantische Bäume, die den Blick nicht frei geben, es gibt nur den Fluchtpunkt, den Horizont, nur das Geradeaus.
Kurz vor Kalaloch passieren wir ein Schild mit SOUTH BEACH CAMPGROUND, darunter zeigt ein umdrehbares Holzschild vier Lettern. FULL. Wir fahren weiter, ein wenig nervös, immerhin ist labour day Wochenende, alle Amis haben den Montag frei, hoffentlich bekommen wir überhaupt irgendwo einen Platz…nach zwei Minuten kehre ich um: Wir sollten wenigstens mal gucken! Ein Traum von Campingplatz. Direkt an der wilden Küste, oberhalb des Strandes, in zwei Reihen parken RVs („Recreational Vehicles“, also Wohnmobile) und stehen Zelte. Der Platz ist nicht groß, aber eines ist sicher: Hier ist noch Platz! Keine Ahnung wer das Schild umgedreht hat. Hier müssen wir bleiben, das ist sofort beschlossene Sache. Ein niedliches älteres Ehepaar lässt uns neben sich parken. Ich bin hundemüde, wir klappen die Sitze hinten um, lassen unsere Matratzen frei und sobald diese aufgeblasen sind bauen wir die Betten im hinteren teil des Autos. Sehr gemütlich sieht das aus. Provisorisch steht jetzt auch mein Einfrau Zelt, aber eigentlich nur weil Franzi es mal sehen wollte. Wir planen definitiv im Auto zu schlafen. Später zeigt sich auch warum das eine gute Entscheidung war. Nach einem ersten kleinen Strandspaziergang sacke ich in einen kurzen, aber tiefen Schlaf. Franzi schreibt währenddessen Tagebuch. Als sie wiederkommt lese ich etwas Panik in ihren Augen. Sie hat ein Schild gelesen, am Strand, ‚beach logs can kill‘, und da waren diese ganzen Fliegen. Sind das vielleicht ‚beach logs‘? Ich muss ein bisschen Lachen, ‚beach logs‘ sind Baumstämme, Treibholz, Franzi. Du sollst beim Baden aufpassen, dass die dich nicht in der Brandung erwischen. Hier liegen wirklich riesige Baumstämme am Strand. Franzi muss auch lachen und ist sichtlich erleichtert, keine todbringenden Fliegen also, ein Glück! Dann ist auch schon Zeit fürs Abendessen, das allerdings etwas kark ausfällt. Ungetostetes Brot, künstlicher Cheddar Cheese und ungeschälte Karotten. Danach eine Banane. Wir haben kein Kocher oder so, unsere Campingausrüstung ist nach Matte, Zelt und Schlafsack zuende. Trotzdem sind wir mehr als zufrieden, wer braucht schon den ganzen Schnickschnack, für ein paar tage halten wir das auch so aus. Ein Stück Papiertüte dient als Teller, Messer und Löffel haben wir bei Starbucks mitgenommen, die eine Rolle Klopapier wischt alles weg. Immerhin haben wir genug Wasser, soweit haben wir gedacht. Nur die Chinesen, die neben uns ausgiebig kochen, machen uns etwas neidisch. Der alte Mann, unser Nachbar, bietet uns einen Platz an seinem Feuer, er und seine Frau gingen schon ins Bett. Leider habe er nur 2 Stühle, sonst könnten wir das junge Pärchen einen Platz weiter noch dazu bitten, das seien auch Europäer, aber er wisse nicht genau woher. Wir sind gerührt und bedanken uns. Leider fängt es fünf Minuten später an wie blöd zu regnen. Wir fliehen mit unser kleinen Essenstüte ins Auto, jetzt sind wir froh keine Tafel aufgebaut zu haben wie die Chinesen. Ganz schön kalt ist es auch geworden. Wir sind so froh über das Auto, keine zehn bigfoots würden uns jetzt in das kleine Zelt kriegen. Wir machen uns bettfertig, müssen uns dazu etwas verbiegen und ein bisschen zeug umschichten. Aber schließlich sitzen die dicken backpacks auf den Vordersitzen und unsere Beine stecken, quasi, im Kofferraum. Könnte hart werden, aber noch ist alles gut. draußen tobt der Sturm, wir sind trocken. Gute Nacht.
Franzi ist hier! Ihr Einstand in den zweiwöchigen Amerikaurlaub sind fünf Tage Haus- und Hundesitting in Seattle, WA. Die Erkenntnis: Gemeinsam Gassi gehen macht viel mehr Spaß als alleine Kackhaufen aufsammeln. So können wir wetten wer dieses Mal mehr Plastiktüten verbraucht. Wir rennen die steilen Straßen hinauf bis die Hunde schnaufen und wir japsen, wir müssen uns spät abends nicht gruseln, wenn wir im Dunkeln durch die Straßen laufen oder die Hunde im Haus bei Geräuschen anschlagen. Und es gibt hier ganz friedliche, aber deutliche Präferenzen: Mishka ist Franzis fette kleine Kuschelkugel, Mr. hyperaktiv McDuffy ist in mich verschossen. Somit ist die Leinenverteilung klar. Gemeinsam erkunden wir die Grünstreifen der Columbia City Nachbarschaft, ein südlicher Bezirk von Seattle. Uns geht es gut: Wir haben ein (bunt bemaltes) Haus, zwei herzzerreißend hibbelige Hunde und jede Menge Zeit und Muße nebenbei die Stadt zu erkunden – nur die Hundeblase gibt uns etwas zeitliche Struktur, aber Mishka und Duffy können ein bisschen anhalten. Seattle ist nett, eine sehr europäische Stadt im Vergleich zu anderen amerikanischen Städten. Vielleicht vergleichbar mit dem entspannten Flair San Franciscos, auf jeden Fall ist es kein LA. Mit 600.000 Einwohnern ist Seattle auch erheblich kleiner als gedacht. Nach ausgiebigen Frühstückssessions am Morgen erschlendern wir uns über die Tage die Stadt: Der Pike Place Market, auf dem Fische fliegen und Gerüche und Genüsse den Appetit anregen, die Space Needle, das Wahrzeichen der ehemaligen Weltausstellung, die Gum Wall (https://blogmopped.com/2015/09/03/the-gum-wall/), der Kerry Park, von dem aus wir die Stadt überblicken können, uns leider nur der Blick auf den Mt. Rainier ver’nebelt‘ bleibt (Seattle ist bekannt für Regenwetter, kennen wir als Hamburger ja). Eingekauft wird im PCC, dem Nobelbiosupermarkt in der Columbia City Nachbarschaft. Franzi ist in love, hier gibt es so leckere Dinge. Aber dafür kosten drei kleine Äpfel auch $4,50. Man freue ich mich darauf wieder in Deutschland einkaufen zu gehen! Ein weiterer Luxus sind die ‚Blondies‘ der Bäckerei um die Ecke, eine Art helle Brownies mit fetten Schokostücken und Walnüssen, schön klitschig und absolut heftig. Aber danach ist man auch im kulinarischen Himmel!
Franzi gefällt diese unkonventionelle Art zu reisen auch, es ist deutlich entspannter nach einem langen Sightseeing-Marsch nach Hause‘ zu kommen, als im Hostel oder Hotel abzusteigen. Hier haben wir alles von Waschmaschine bis Kühlschrank. Im Ofen backt ein Birnenkuchen, mit Früchten vom Baum vor der Tür. Wir sitzen am Küchentisch während Mishka und McDuffy ihre rauen Zungen an unseren Beine entlangführen, jedem Zeh wird ausgiebig Aufmerksamkeit entgegengebracht. Eindeutiger Leckfetisch! Oder Mineralienmangel. Nachdem ich am ersten Morgen vom Laufen zurückgekommen bin, schweißüberströmt (heftiges Höhenprofil in dieser Gegend), haben die Hunde Lunte gerochen, vielmehr Salz. Seitdem können wir sie nicht mehr vom Schlabbern abbringen, die Hoffnung auf ein kleines bisschen Schweiß stirbt zuletzt! Jedes Stück nackte Haut wird sofort bespeichelt. Am Mittwoch bringen wir Mishka an den Rand ihres Lungenvolumens. Die Sonne scheint, kurze-Hosen-Wetter, der richtige Tag für einen Ausflug an den nahegelegenen Lake Washington. Eine halbe, dreiviertel Stunde läuft man, und das von hier oben vom Haus quasi nonstop bergab. Ich dachte Hunde können immer laufen. Aber Mishka hat ein bisschen Übergewicht und hechelt ganz schön. Auf der finalen Geraden zum See ist dann zwar nicht Ende Gelände aber finito für den Hund. Sie legt sich einfach hin und will nicht weiter. Franzi spielt Superwoman, schultert Mishka kurzentschlossen und weiter geht der Spaziergang. Zurück ist wieder etwas Puste da, nur die Steigung in der 42. Straße muss nochmal auf dem Arm überbrückt werden. Dort treffen wir dann auch Gary, was Mishka eine dreiviertelstündige Pause einbringt. Gary. Wieder so eine unerwartete Begegnung. Er spricht uns an, während wir den Hügel erklimmen und er Einkaufstüten aus seinem Auto lädt. Ein hagerer, braungebrannter, weißhaariger Mann, um die 65 schätzen wir. Irgendwie entwickelt sich ein Gespräch, obwohl Gary ehrlich gesagt mehr redet als wir, von der Flüchtlingssituation in Europa („I read the Economist!“), von der furchtbaren (Außen)Politik seines Landes („I don’t like my country!“), von der wilden Vergangenheit. Gary ist schwul und er erzählt ganz frei und begeistert von den 70ern in San Francisco, von Parties und Drogen und Aufständen, vom guten Leben, davon, dass er genug Geld hat, gerade in Indien war, wie er dieses Land, Indien, liebt. Und mit leuchtenden Augen erzählt er von seinem Enkelsohn, den Stolz eines liebevollen Großvaters in der Stimme. Mishka hat sich inzwischen auf die Seite gerollt und lässt sich auf dem warmen Asphalt die Sonne auf den Bauch scheinen. Er fragt uns was wir machen, Franzi erzählt von ihrem Studium der Sozialen Arbeit. Als mich die Frage trifft, muss mir wieder anhören „Oh, and what are you going to do with that?“. Ich liebe es. Demnächst erzähle ich ich bin Gärtnerin,.. „Would you like a smoke?“, fragt Gary uns. Wir lehnen dankend ab, auch als er uns dazu noch einen Kaffee anbietet. Vielleicht hätten wir annehmen sollen, denken wir später, das hätte diese Geschichte noch spannender gemacht. Gary lässt uns aber nicht einfach so ziehen, wenigstens Blumen aus seinem Garten will er für uns schneiden. Der Garten ist seine Leidenschaft. Vor dem griechischen Haus, weiß gestrichen mit blauen Tür- und Fensterrahmen (es hat wirklich einem Griechen gehört!), wachsen Blumen aus allen Ländern dieser Welt (Anmerkung: Ich wollte gerade aus aller Herren Länder‘ schreiben, da schaltet sich mein Genderbewusstsein ein…Floskeln!!). Wir bekommen einen Strauß aus Äthiopien, Südafrika und eine gelbe Rose. Damit verabschieden wir uns, gerührt, aber auch ein bisschen froh weiterziehen zu können. So viel casual Smalltalk ist für uns doch immer noch ein bisschen anstrengend, ein kultureller Unterschied, Amis können einfach lange und viel reden.
Mishka hat wieder Puste, sie kann schon wieder andere Hunde angiften. Und McDuffy schnappt nach einem vorbeifahrenden Radfahrer. Wir wechseln die Straßenseite, um Konflikte zu vermeiden. das haben John und Elizabeth uns sowieso geraten. Wir beobachten, dass das hier eigentlich alle Leute tun. Hunde sind in Seattle nicht besonders ’sozialisiert‘, In Deutschland lernt man durch Hunde andere Menschen, Hundebesitzer und deren Vierbeiner kennen. In Seattle treffen wir, so kommt es uns vor, keine Menschen- und Tieresseele. Franzi vermutet, dass hier kaum jemand Hundeschulen besucht. Und dass viele Besitzer ihre Hunde nur kurz ausführen oder in die Hinterhöfe und -gärten lassen, statt ausgiebiger Gassigänge. Die Hunde ziehen an den leinen, kläffen alles an was sich bewegt. Mishka hat Übergewicht, McDuffy einen Kreislauftick – ständig bleibt er stehen, dreht eine Runde um mich und wenn er vorne wieder ankommt muss ich über die Leine springen. Außerdem zerfetzen die beiden liebendgerne Unterhosen, nichts darf einfach liegengelassen werden. Ich habe einen gestreiften Schinkenbeutel zu beklagen, in dem hat Mishka ihre Zähne versenkt. Oh und die Kackbeutel sind hier übrigens nicht zwingend schwarz, wir hatten ein durchsichtiges rosa und grün. Durchsichtig…wer will denn sowas?
Am letzten Abend, bevor John, Elizabeth und Anica wiederkommen – übrigens eine äußerst liebenswerte Familie! – gönnen wir beiden Blondies uns ein fancy Abendessen im ‚Tutta Bella‘, dem lokalen Italiener. Dann ist es Zeit die Rucksäcke zu packen und eine letzte Nacht ausgiebig Schlaf zu sammeln. Die nächsten Tage werden wilder: Ein Roadtrip steht bevor, der Olympic National Park erwartet uns. Good bye doggies, good bye Seattle – wir sehen uns in ein paar Tagen nochmal wieder. WUFF !








Speichel der Jahrhunderte! Oh Keim, in meinem Mund bist du entstanden, kleb‘ nun hier und pflanz‘ dich fort! Ein Reich für das Chewing Gum. Kunst am Kaugummi! Die Gum Wall ist wohl Seattles gewöhnungsbedürftigste Sehenswürdigkeit. Aus der Not entstanden, eine ratlose Stadt, die ein Problem in eine Touriattraktion umwandelte. Ein Mann inspiziert die kaugummibeklebten Wände. „So“, sagt er in einem feststellenden Tonfall, als sei ihm gerade etwas Entscheidenes klar geworden, „this is where gum goes to DIE“. Sein Freund neben ihm schüttelt den Kopf und in einem schaurig verschwörerischen Flüsterton raunt er „No, this is where gum goes to LIVE.“ Schallendes Gelächter, die umstehenden Touristen haben es auch gehört. Wir posen weiter, fotografiern die kuriose location und sind gefangen zwischen Ekel und Faszination. eine Gasse voller Kaugummi. Und wir leisten, natürlich, unseren Beitrag. wir haben mitgedacht und etwas zu Kauen mitgebracht. Ein paar kräftige Bisse, ein wenig Speichel, jetzt nur noch die richtige Stelle finden. Dort an der Wand? Oder doch lieber an dem Gitter hier? Schließlich haftet das Kunstwerk in der bunten Masse, wir haben unsere Spur hinterlassen, unser Fähnchen geklebt, Zeit diesen widerlichen Ort zu verlassen. Möge der Speichel mit uns sein!
Ann schließt ihre Augen, in ihren Gedanken wandert sie zurück in ihre Kindheit, erinnert sich an die Geschichten ihrer indianischen Vorfahren. Sie will uns die Mythen erzählen, die ihre Großmutter ihr erzählt hat. „Time to get in granny mood“, she says and takes a deep breath. Es ist schon 21 Uhr, das Licht schwindet, wir sitzen in einer nebligen Augustnacht auf dem Dock in Bandon, Oregon. Langsam kriecht die Feuchtigkeit in meine Klamotten, ich kauere mich auf dem Campingstuhl zusammen, mit den Armen die angewinkelten Beine umschlungen. Unsere Krebskörbe hängen im Wasser, mit altem stinkigen Hühnchenfleisch als Köder gefüllt – das mögen die Krebse, wahre Gourmets. Das Wasser steigt, die Flut treibt unsere Beute in die Mündung des Coquille Rivers. Heute Nacht sind wir Jäger. Ann atmet aus und beginnt. Es ist die Geschichte des Wolfsjungen, der klein und schwächlich in Zeiten des Hungers geboren wurde, der, weil er für seine kümmerliche Erscheinung gehänselt wurde, Ärger und Hass in sich trug, alles um ihn kurz und klein schlug. Bis eine alte Indianerfrau ihn vor die Wahl stellte: There are two characters inside of you and you have to choose which one you want to be. The wolf or the owl, the angry outsider or a social part of the community. Er verbrachte viele Tage und Nächte im Wald, überlegte wer er sein wollte. Schließlich kehrte er zu seinem Stamm zurück, mit der Entscheidung eine Eule zu werden. Seine Aggressionen verschwanden, er wandte sich seinen Stärken zu, wurde der beste Bogenschütze im Land und, als seine Zeit gekommen war, wurde er ein beliebter Häuptling, der für das Wohlergehen seines Stammes sorgte. Das Licht des Mondes bricht hinter den Wolken hervor, es lässt die Nebelluft noch milchiger erscheinen. Wir sind die letzten Wächter des Docks, die ausdauerndsten Krebsfischer von Bandon heute Nacht. Bis auf ein paar adlergroße Möwen. die aufmerksam auf den Holzplanken um uns herumtappen – sie warten auf ihren Happen der Beute. Ein Robbenkopf taucht dann und wann auch aus dem Wasser auf, wir hoffen, dass dieser Jäger nicht auf unser stinkiges Fleisch in der Tiefe steht…. Welche Geschichten könnt ihr erzählen? fragt Ann in die Runde. Schweigen, keiner traut sich. Haben wir das Geschichtenerzählen verlernt? Haben wir es überhaupt jemals erlernt? Wir haben kaum orale Kultur, eine wie die Indianer sie pflegten. Mündliche Überlieferungen sind selten, Geschichten wurden eher gelesen als erzählt. Aber wir leben und erleben, täglich. Wir haben Geschichte(n), Leid und Freud erlebt. Geschichte! Damit brüsten wir Europäer uns doch immer vor den Amis. Ich beginne, erzähle von der Vergangenheit meiner Großeltern, von der Kinderlandverschickung im Krieg und von der Flucht aus Breslau. Mervé aus Rhode Island hat türkische Wurzeln, sie erzählt vom Aufwachsen mit zwei Kulturen, von ihrer liberalen Mutter und ihrem konservativen Vater, vom Wert der Familie in der Türkei und sie vergleicht, kontrastiert die Herzlichkeit der türkischen Kultur mit der gespielten Harmonie vieler amerikanischer Familien, setzt die Zusammenkunft dem Materialismus gegenüber, emotionale Ehrlichkeit statt verzweifelter Fassade. Die Mädels aus Utah, Mekela und Sammy, sind zunächst still, lauschen den Geschichten aus einer für sie fremden Welt, sie haben Utah bisher kaum verlassen und fragen schüchtern wo die Türkei liegt. Mit 18, gerade die High school verlassen, kein Wunder, wer könnte es ihnen übel nehmen. Aber sie sind neugierig, wollen studieren, nur das Geld macht ihnen sorgen. Warum, fragt Mekela sichtlich empört, kann es sein, dass ihr in Deutschland fast umsonst studieren könnt und wir müssen so viel zahlen? So kommen auch die beiden ins Reden, erzählen von ihren Hoffnungen und Ängsten, von den möglichen Studiengängen und den vergangenen Sommerabenteuern. Irgendjemand beginnt eines dieser alten Mädchenklatschspiele vom Schulhof. Wir alle haben sie gespielt, kennen andere Texte, aber die gleichen Rhythmen, wir klatschen und lachen schallend in die stille Nacht hinein. Irgendwo klingt Karaokegesang aus einer Bar. 22:30 Uhr: Poor George ist noch immer einzige Krebs, der in unserem Eimer mit den Scheren klackert und angstvoll die Stielaugen bewegt. Der Arme. Ich komme mir vor wie Kaiserin Sissi, die den Papi davon abbringt die niedlichen Tiere zu schießen: Ich möchte ihn retten, freilassen! Wir dürfen ohnehin nur Männchen fangen, und die müssen die entsprechende Größe haben. Alle außer George mussten wir wieder in die Freiheit schütteln und kicken, die Weibchen – wir erkennen das Geschlecht durch die Maserung der Panzer – sind besonders aggressiv. Fasst man jedoch die Männchen von hinten an ihren Panzer verharren sie, sind fast regungslos, kampflos ergeben sie sich uns Amazonen der Nacht. Doch es ist keine ertragreiche Nacht. George bleibt der Einzige und das ist sein Glück. Letztendlich schenken wir auch ihm die Freiheit, sein Tod ist ein karges Mahl auf unserer Seite nicht wert. Dann packen wir zusammen, holen die Leinen und die Körbe ein. Der Rest Gammelfleisch geht an die Möwen und die Robbe, tut euch gütlich daran! In einer Nebelkaravane trotten wir vom Steg, durch die Nacht, ein leichter Wind weht Fischgeruch durch die Straßen von Bandon, das Donnern der Brandung dringt vom Meer herüber. Schlafenszeit.


Berries that are blue: Good for you./ Berries that are red: Use your head./ Berries that are white: you die tonight. Eine alte Indianerweisheit, die Ann uns mit auf den Weg gegeben hat. Ich traue mich trotzdem nicht alle blauen Beeren bedenkenlos vom Busch zu rupfen und in den Mund zu stecken. Ein Glück sind wie nicht auf diese Futtersuche – foraging – angewiesen. Im Haus erwartet uns ein selbstgekochtes Clam Chowder…
Neben Couchsurfing und Housesitting stand Wwoofing (www.wwoofusa.org) auf meiner Liste für diese Reise, eine weitere Möglichkeit Geld zu sparen, Einheimische kennenzulernen und neue Erfahrungen zu machen, vielleicht sogar neue Fähigkeiten zu erlernen. WWOOF steht für „Worldwide Opportunities on Organic Farms“, wwoofing beschreibt demnach das Arbeiten auf einer Farm o.ä. im Gegenzug für Unterkunft und Verpflegung. Das ist der Deal. Meinen Deal habe ich mit Ann und Robin geschlossen, die in der Nähe des Städtchens Bandon an der Küste von Oregon ein 22 Hektar großes Stück Land, eher Wald, verwalden…äh verwalten. Aber in gewisser Art auch ‚verwalden‘. Long story short: Über viele Jahre und Besitzer haben sich unzählige Pflanzen dort angesiedelt, die invasiv, also nicht heimisch sind. Neben der (natürlichen!) Bekämpfung dieser Arten wollen Robin und Ann eine Art Waldgarten fördern, das bedeutet vor allem essbare lokale Pflanzen wieder ansiedeln. Damit auch, neben dem eigenen Gebrauch, wilde Tiere im Winter hier Nahrung finden können. Ein super Projekt. Nebenbei haben sie einen eigenen Gemüsegarten, um die 12 Hühner, ein altes Springpferd namens Tobi und einen scheuen, nachtaktiven Stier namens Eric. Nicht zu vergessen die zahlreichen Katzen und der alte Haushund Jessi.
Ich muss zugeben: Ich war nicht von Anfang an begeistert. Um ehrlich zu sein wollte ich schon am ersten Tag sofort wieder abfahren. Warum? Das Wasser, das aus dem Hahn kommt, ist rostbraun und riecht nach Blut. Eisen! Der Brunnen auf dem Grundstück ist nicht sauber, kein Trinkwasser hier in unser Wwooferküche in der Scheune, Wand an Wand mit dem Pferdestall. Aus verstaubten Kanistern sollen wir Trinkwasser kriegen, obendrauf liegen Mäusekötel, ich will nicht wissen wie es IN diesen Behältern aussieht. Es gibt keinen Kühlschrank, nur eine Truhe in der Butter und Käse im Fleischsaft schwimmen. Hundehaare wirbeln durch die Luft, Spinnen spinnen Weben in jeder Ecke über Teller und Tassen, die Regale liegen staubverkrustet und eine Kruste hat sich auch am Boden des Mülleimers gebildet, darin tun weiße Maden sich gütlich, winden und kriechen und bohren. Diese Entdeckung ist der Zeitpunkt, an dem ich sofort wieder gehen will. Ich bin empört, erzürnt. Unglaublich, wie kann man uns so etwas zumuten? Ich beginne in meinem Ekel zu schrubben bis die letzte Made verschwunden ist, die Hundehaare und Spinnenweben werde ich niemals besiegen. Trotzdem sieht es nach 4 Stunden schon sehr viel besser aus. auch wenn das Wasser immer noch unerträglich riecht… Ich weiß nicht, ob ich hier drinnen etwas kochen kann, überhaupt etwas essen will. Mir ist leicht schlecht, von dem Geruch, der Empörung und vor allem vond er Müdigkeit, die mich jetzt überfällt. Seit über 30 stunden bin ich wach, mit einer Mitfahrgelegenheit die ganze Nacht gefahren, 9 stunden von San Francisco bis hier hoch. Aber schlafen? Dazu muss ich zunächst mein Zelt entkernen…eine weitere stunde fege ich Dreck, besiege Spinnen und verjage Ohrenkneifer, wasche die Klamottenkiste und präpariere mein Bett. Duschen? Niemals, die Dusche ist in der Scheune und wird ebenfalls mit blutigem Brunnenwasser gespeist, nicht auf meiner Haut! Da stinke ich lieber zum Himmel! Als ich endlich erschöpft ins Bett falle rasen meine Gedanken weiter, drehen sich um Alternativen. Nur ein scheinbar sicherer Gedanke: Ich muss hier weg! Wie soll ich es 11 Tage hier aushalten? Morgen kommen noch drei andere wwoofer, übermorgen beginnen wir mit der Arbeit, noch sehe ich das nicht…Ich jammere und bemitleide mich um diese erste grauenvolle Erfahrung, da mischt sich plötzlich eine andere stimme in das Chaos….Ich liege auf der gemütlichen Matratze und höre den Wind in den Pinien rauschen, nicht weit entfernt die Brandung des Pazifiks donnern. Die Nachmittagssonne scheint warm, es riecht nach Frankreich, Piniennadeln im Sonnenlicht. Ist es so schlimm hier? Ich bin frei in meiner Entscheidung, ich kann gehen, ja, ich kann mich aber auch entscheiden es durchzuhalten, mich dieser Erfahrung bewusst auszusetzen. Es ist nicht der Rest meines Lebens, es sind 11 Tage, Herrgott! Stell dich nicht so an! Und über das Wasser kann man ja reden, Wasserhähne und eine Dusche gibt es schließlich auch im (sehr viel zivilisierteren) Haus von Robin und Ann…
Es war die beste Entscheidung zu bleiben! Diese 11 Tage waren eine einmalige Erfahrung, eine interkulturelle Bereicherung, eine Oase der Ruhe für meine unruhige Seele und eine Quelle von Kreativität. Robin und Ann haben für uns, mich und Mervé, Sammy und Mekela – die anderen drei wwoofer Mädels – ein Programm zusammengestellt, das neben der Arbeit auf dem Grundstück noch genug Zeit lies fürs Beerensammeln und Marmeladekochen, Peace-Rocks-bemalen, Krabbenfischen (http://www.blogmopped.com/2015/08/26/the-art-of-crabbing), Treibholzsammeln, für Strandspaziergänge und Stadtausflüge. Bei regelmäßigen `family dinners‘ wurden wir bekocht oder durften die beiden Gastgeber bekochen, von meiner Seite gab es Spätzle und Tiramisu. Als finalen Nachtisch manchmal Gras, Weed, in Oregon mittlerweile legales Gemütsgemüse. Robin und Ann haben uns viel erzählt, uns über amerikanische Politik aufgeklärt – als lesbisches Paar absolut anti-Republican, kein Wunder. Sie haben von ihrer radikalen Einstellung (we believe the system is wrong! we need to change it!) und rebellischen Vergangenheit, von harten Zeiten der Diskriminierung und dem Beginn der Pride Bewegung erzählt, von überzeugtem Feminismus und anhaltender Diskriminierung gesprochen. Wir haben über Linguistik und Kochrezepte geredet, über native american history und lokale Pflanzenspezies, aber auch über Deutschland , Europa, Amerika – die kulturellen Unterschiede. Die beiden haben uns mit ihrem Wissen beeindruckt, Ann als ehemalige Professorin und Indianerin, Robin als Biologin und Botanikerin. Beide sind um die 60, die Erfahrungen sind ihnen ins müde Gesicht und in die kaputten Körper geschrieben, aber ihre Stimmen sind stark. Mein innerer Stereotypenmanager hat mal wieder ordentlich eins auf den Deckel bekommen, der erste Eindruck, vor allem der äußere Eindruck: bullshit! Wie oft hängt man später mit seinen Vorurteilen in der Luft und merkt, dass der Weg hier nicht weitergeht, sondern in eine ganz andere Richtung führt. Mal wieder was gelernt…
Unser Erzfeind dieser 11 Tage ist GORSE. „Gorse“ ist das Englische Wort für Ginster. Ein Ire, George Bennett, hatte Ende des 19. Jahrhunderts einige Ginsterpflanzen aus England importiert, er soll Heimweh gehabt haben. Seitdem hat der Ginster die Herrschaft übernommen, als invasive Spezies überwuchert er die einheimischen Pflanzen. Heimtückische pieksige Biester, die ihre Zweige an jeder lichten Stelle ins Sonnenlicht recken, um zu gedeihen. Von kleinen Büschen mit dünnen Stängeln bis hin zu kräftigen Bäumen mit dicken Stämmen. Ganz Bandon ist wegen des öligen Ginsters schon abgebrannt. Doch wir haben die ‚Stiehl‘, unsere allmächtige mörderische Säge. Die großen Scheren, die Mistgabeln und vor allem haben wir unseren Willen. So rücken wir aus, jeden Morgen, nach einer kurzen Meditation mit Ann im Wald, um dden ginster zu schneiden. Wir raspeln und sägen und knipsen und fegen und häufen und schwitzen, höher und höher wachsen die Ginsterberge auf dem Gelände, freier und freier wird der Wald. Wir befreien bedrängte Rhododendren, beengte Pinien und die seltenen Port Orford Zedern, legen dann und wann versteckte zäune frei in die sich der Ginster gefressen hat und schlagen uns den Weg durchs Dickicht, um Trails freizuschneiden von dem Biest von Gorse. Burn Baby, burn! Zu gerne würden wir sie anzünden, die Stapel brennen sehen, aber noch sind Feuer verboten. Waldbrände wüten im hinterland, erst im Winter werden sie brennen. Immerhin werden sie bis dahin nicht mehr wachsen.

Tobi, der alte Springzosse. 36 Jahre auf dem Buckel.
Ann zeigt uns wie wir unsere „Gorse Waffe“ schärfen. Während sie die Werkzeuge erklärt legt sie viel feministisches Gedankengut an den Tag und ermutigt uns, alles auszuprobieren. Die Essenz: Alle Werkzeuge, die Männer benutzen können, könnt ihr auch bedienen!
GORSE…Ginstergebirge türmen sich überall!
Der wilde Surf kracht gegen die Felsen in der Brandung, nicht wüstenrot, sondern weiß von Seevogelkack, nur schemenhaft zu erkennen wenn, an Tagen des Nebels, sich die Küstenlandschaft in einen milchigen Schleier mystisch verhüllt. Dann strecken sich Äste bizarr aus dem Sand, in der Ferne tauchen Geister auf, bis in der Nähe sie zu Gefährten, streifenden Strandwanderern, werden. Goldene Tage, an denen die Sonne durch die Pinien und ihr Licht sich auf der Wasseroberfläche bricht, Der Pazifik mal weiß und windgepeitscht, mal beschaulich und blau – aber niemals zahm. Diese Wasser sind wild, es donnert die Brandung als immerwährende Hintergrundmelodie. Am Strand, mächtige Stämme bleich gespült, über Wanderdünen kreisen Möwen picken Krebspanzer im mäandernden Devils Creek, der sich aus dem Hinterland hinaus ins Meer windet und Reflektionen in der Abendsonne spiegelt. Manchmal Erinnerungen, an die Westküste Neuseelands, manchmal sehe ich auch Sylt im Strandhafer der Dünen. Jeden Morgen, jeden Abend, barfuß, mit Kaffee in der Hand, in Laufschuhen über den ebbeharten Sand während die auslaufenden Wellen an den Laufschuhen lecken, die Nase im Wind, das Herz poetisch. An der Küste von Oregon.
Mark Twain soll gesagt haben, dass die kältesten Winter, die er jemals erlebt hat, die Sommer in San Francisco waren. Ich weiß nicht, ob es die Klimaerwärmung ist oder einfach mein Glück: Mir brutzelt auf der Terrasse des Java Surf Cafe am Ocean Beach die Sonne auf den Kopf. In fünf Tagen habe ich die Golden Gate Bridge nicht einmal in ihrem berüchtigten Nebelmantel erlebt. Nur der Pazifik schickt dann und wann am Abend eine kühle Brise durch die steilen Straßen und dann kommt der einzige Pulli in meinem Rucksack mal sinnvoll zum Einsatz. Ich bin mehr als zufrieden mit diesem San Francisco Sommer. Als ich am Dienstag Abend ankommen und mit der Straßenbahn Richtung Ocean Beach fahre, die Straße auf den Schienen hinuntergleite, die direkt in den Pazifik überzugehen scheinen, bin ich genauso fasziniert wie vor zweieinhalb Jahren (https://blogmopped.com/2013/02/23/the-left-coast/). Das Flair hat sich nicht verändert, meine Begeisterung von damals kehrt zurück. Ich bin ein wenig erleichtert, weil meine Erwartungen mir selbst zu hoch schienen. Aber diese Stadt ist eine zweite Perle, sorry Hamburg.
Fünf Nächte mache ich mich auf Lenas und Antons Couch lang, in einem Haus, das wie ein kleines blaues Märchenschloss aussieht, nur neun Straßen vom Wasser entfernt, wieder so ein günstiger Zufall. Mama schüttelt am Telefon verwundert den Kopf (das sehe ich zwar nicht, klingt aber so) „durch das Surfcamp in Frankreich kennst du ja die ganze Welt“. Zumindest Leute, die in der ganzen Welt unterwegs sind. Lena macht Praktikum, Anton hilft hier und da mit seinen Grafikdesignkenntnissen aus und erkundet ansonsten die Stadt. Da reihe ich mich ein, wir legen einige Meilen und Hügel zurück. Abends und am Wochenende ist Lena auch dabei. Entspannte Tage, Kneipenabend, Ausstellungseröffnung im Goetheinstitut, Tacco Kochsession mit leicht esoterischer Mitbewohnerin und ein hardcore Biketrip. Biketrip, mehr dazu:
Eine Radtour über die Golden Gate Bridge ist eine unbestehbare Geduldsprobe! Natürlich, bleib mitten in der Kurve stehen! Oder am besten direkt auf dem Radweg, das Fahrrad quer abgestellen, Super! Klasse! Nein, rechts bleiben, wieso? Und Geradeausfahren, das wäre nun wirklich zu viel verlangt. Auch plötzlich Bremsen ist gar kein Problem, besser noch ist: nach einer Fotoknipspause am Rand der Fahrbahn (ach nein, mitten im Weg) ohne sich umzuschauen wieder wacklig aufs Fahrrad zu krabbeln und die Fahrbahn zu queren. Ich kriege einen Föhn und ringe verzweifelt um meine interkulturelle Kompetenz, versuche mir diverse kulturelle Brillen aufzusetzen (vor allem asiatische!) und mir einzureden, dass nicht jeder mit Radfahren groß wird wie wir. Aber nach drei, vier mal stummem Kopfschütteln und haarscharfer Kollisionsvermeidung durch Vollbremsung platzt mir der Kragen. Ich komme mir vor wie ein überkorrekter deutscher Assi, aber ich habe jetzt einfach Lust Leute anzuschreien und zurechtzuweisen. EY! You cant stop here! What the hell! Fahrtechnisch wähle ich jetzt die aggressive Scherentaktik. Radikales Ein- und Ausscheren. Wann immer der Gegenverkehr kurz abreisst breche ich aus der schleichenden Radkaravane aus, überhole ein paar keuchende Hackenpedaler und reihe mich ein bisschen weiter vorne wieder ungeduldig ein….Die Golden Gate Bride ist ein Touristenmoloch, das war uns natürlich vorher klar. Besonders an einem Samstag. aber wir wollen sie ja nur überqueren, um die Perspektive zu wechseln. Und sobald wir die Marine Headlands am anderen Ufer erreichen stellt sich dieser Gedanke als richtig heraus. Die erste Steigung siebt die radelnde Menge radikal aus, 5% wenn es hochkommt wählen diesen Weg, davon zum Großteil Rennradfahrer, die sportlich unterwegs und von der Massenveranstaltung mindestens so genervt sind wie wir. Unsere Räder sind nicht gerade Renner (aber schön retro, aus einem alternativen Fahrradladen wie man sich den in SF so vorstellt, mit karohemdbärtigen Hipster!), aber unsere gestählten Waden und die Aussicht auf eine schöne Aussicht tragen uns den Berg hinauf. Auch die zweite langgezogene Steigung bewältigen wir, pushen uns mit Tour de France Kommentator-Euphorie und der imaginären Jagd auf das gepunktete Trikot hinauf. Jede Anhöhe, jede Kurve gibt einen neuen Blick auf die Brücke und die Bay Area frei. Ein paar Fotos, dann stehen wir plötzlich vor einer ganz anderen Herausforderung: 18% Gefälle! Die Hände klammern sich um die ledernen Griffe, gefährlich schwitzig glitschig, fassen krampfhaft um die Bremsen. Scheiße ist das steil! Das Kopfkino geht über die Fahrbahn hinaus, den Hang Falllinie hinunter. Aber sobald das steilste Stück hinter uns liegt führt die Straße uns in einem angenehmen Gefälle hinunter, entlang einer sanft geschwungenen Straße, die mich an ein stimmungsvolles Longborad downhill Videao erinnert, zum Point Bonita Lighthouse. Wind in unseren Haaren, noch viel angenehmer: Wind unter unseren Achseln! Nach Lunch und Schnapschüssen am Leuchtturm müssen wir zum Glück die 18% nicht wieder hoch, sondern fahren in einem Bogen durchs (vertrocknete) Hinterland wieder zurück zur Brücke, die jetzt am Nachmittag deutlich leerer ist. Ein Glück!
Dann packe ich wieder meinen Rucksack, heute Abend holt Natali mich ab. Meine erste Mitfahrgelegenheit in den USA. Bisher nur Bus und Bahn, jetzt mal mit dem Auto. Unser Weg wird uns über Nacht 600 Meilen gen Norden führen, nach Oregon. Nahe der Stadt Bandon werde ich die kommenden zehn Tage wwoofen, soweit ich weiß Bäume ausreissen…ich werde berichten.
Ich surfe mich durch Kalifornien. Bisher eher auf Sofas als auf Brettern. In Shell Beach, einem kleinen Küstenort auf halber Strecke zwischen Los Angeles und San Francisco, stoppe ich zwei Nächte bei Jamie und Mitus (wuff!). Jamie überlässt mir sein kleines Studioappartment, einfach so, und zieht zwei Tage zu seiner Freundin. Im Zimmer steht einer dieser alten bunten Applecomputer, am Boden ein Plattenspieler, daneben stapeln sich die vinyl records, ich stöbere durch das Bücherregal: Murakami Romane, ein fetter Schinken mit dem Titel „the history of surfing“, Kochbücher über vegetarische und vegane Küche, ein paar Grafic Design Bücher und mehrere California National Parks und hiking guides. Ich beginne Murakamis ‚South of the Border, West of the Sun“ zu lesen und bin gefangen. Dies ist meine zweite Murakami Begegnung während der Reise, Ricky’s Sohn Josh war wie Jamie bekennender Murakami Addict und hatte die volle Kollektion der Werke im Regal. Cut! Am Tag gehen wir mit Mitus spazieren, Jamie zeigt mir die kleinen Parks an der schroffen Steilküste, seine Werkstatt in der er Möbel baut und führt mich durch die Studentenstadt San Luis Obispo. Er ist selbst viel auf Couches unterwegs gewesen, einige Monate hat er in Neuseeland in einem Campervan gewohnt. Ich entdecke sofort den Raglan Sticker auf seinem selbstgeshapten Longboard und bekomme Fernweh in der Ferne. Jamie sagt er freue sich auf den Herbst, „autumn“. „Autumn?“, frage ich. „Right, Americans say fall, i got autumn from New Zealand“. Herbst. Poetisch. Kalifornien bekommt im Sommer nicht viel Welle ab, aber gegen Ende September erreicht der Winterswell die Küste. Hier färben sich keine Blätter bunt, aber an den Wellen merkt man, dass der Herbst einzieht. Dann arbeitet er auch manchmal nachts, „we have a short surfing season, you know. Surf’s the priority during winter“. Er hat eine App auf seinem Telefon, webcams zeigen die Spots und Bojen lösen Alarm aus, wenn sie eine bestimmte Richtung und Höhe der Wellen registrieren. Hier schwingt der endless summer in jedem Schritt des Lebens mit. Unabhängig von der Jahreszeit. Man wartet auf das Ende des Sommers, wartet auf die Wellen. Ein Elfchen, in Erwartung des kalifornischen Herbstes:
california fall
–
california
in fall
no colored leaves
but swell will bring
waves.
 Jamie and Mitus – thank you guys.
Jamie and Mitus – thank you guys.
Einen fantastischeren Namen für einen Zug kann es selbst im Disneyuniversum nicht geben: Pacific Surfliner. Sundown Express würde auch passen, oder Coast Starlight (wait: den gibt es sogar! Von Seattle bis San Francisco). Vielleicht kommt der Zug direkt aus Hollywood und drinnen gibt es Berty Bott’s Bohnen aller Geschmacksrichtungen. Muss ich nach Gleis 9/3 Ausschau halten? Lautet das Ziel auf der Bahnhofsanzeige „Paradies“?
Auf einer Länge von über 500km verbindet der Pacific Surfliner die südkalifornischen Städte San Diego und San Luis Obispo. Ein Großteil der Bahnstrecke führt direkt an der Pazifikküste entlang, keine Straße und kein Wanderweg kommt dem Wasser näher als die Schienen des Zuges. Drei Mal habe ich bisher die Landschaft vor dem Fenster an mir vorbeifliegen sehen, ohne zu merken wie die Stunden vergehen, zu beschäftigt hinauszuschauen und die Magie mit der Kamera einzufangen. Von Santa Barbara nach Ventura, dann zurück von Carpenteria nach Santa Barbara. Der erste Ritt durch das kalifornische Abendlicht. Die beste zeit diesen zug zu erwischen ist zwischen 18 und 20 Uhr. Kein Hollywoodstreifen kann ein besseres abendrot zeichnen, Casper David Friedrichs Sonnenuntergänge live. No need of a filter! Lange, einsame Strände, die Blautöne des Meeres verschwimmen in der Endlosigkeit des Horizontes, in der Ferne im Dunst die Schemen der Bohrinseln. Palmen säumen die Ufer, das Rot wird pink, dazwischen mischt sich Babyblau. Die Hügel des Los Padres national Forest im Hinterland, zur anderen Seite des Fensters, sind die stetige Hintergrundkulisse. Sie schirmen vom Rest der Welt ab, hier gibt es nur raue Küste und sanfte Hügel. We are all at sea. Stop! Ich will hier aussteigen! Da sind ein paar Wohnwägen am meer, darf man hier etwa campen? Ich bin bereit mit meinem Rucksack loszulaufen, nur noch zu zelten.
Dann die Fahrt von Santa Barbara nach Grover Beach, die letzte Station vor San Luis Obispo. Ein Abschnitt, bei dem der Zug und der Ozean eine Einheit zu formen scheinen. Schon auf der Karte sieht die Strecke spektakulär aus, windet sich mit der Küste gen Norden. Ein Stop heißt einfach „Surf“, ein paradiesisch einsamer Bahnhof, nur der Pazifik, ein Strand (mit Warnung vor Haien, später höre ich von surfern, dass es da draußen ziemlich „sharky“ ist) und weites, kaum bewohntes Hinterland. Wieder die perfekte Zeit, wieder optimales Wetter. Märchenlandexpress. Ein Video und ein paar Bilder, das ist alles was es zur Erklärung braucht. Ich verabschiede mich für zwei Stunden aus der Welt, stöpsle meinen iPod ein und schaue hinaus. Diese Fahrt ist reine Poesie. Wann habe ich das letzte Mal 2 Stunden ohne Unterbrechung aus dem Fenster gesehen?
Santa Barbara/ Goleta, CA – Aug 6th, 2015
A cycle of life./ „Would you dance, if I asked you to dance?“/ plays as the soundtrack of an hour dedicated to cleaning/ Clothes be cleaned/ But it’s the dirt that tells the stories/ To begin anew though, we need to be clean/ The dirt is our past, our identity/ A few more rounds then tumbled dry/ Stumbling and tumbling into a new beginning/ Rebirthed but still the same at heart/Folded nicely, regaining order/denying chaos for a little while – though aware that the dirt will return/ Aware of this recurring cycle of clean and dirty/ Aware of the inevitable cycle of life.
 Der Wind scheint hier nie einzuschlafen, Heftige Böen wirbeln die Staubkörner der ausgedörrten kalifornischen Erde durch die Luft, Die äußere Plane meines Zeltes knallt und peitscht wie ein flatterndes Segel im Sturm. Ich kauere mich in meinen Schlafsack, lausche, hoffe und bete nach jeder Böe, dass sich auch der Wind schlafen legen möge. Doch jede Stille ist nur ein weiteres Einatmen. Meine Hüfte schmerzt auf der sich – kaum – selbstaufblasenden Isomatte, es zieht kalt in meinen Schlafsack und ich ziehe meine Windjacke über das Top, das längärmlige Tshirt und den Merinowollpulli. Weiter tobt der Sturm. Der Sand ist so fein, er dringt durch das Belüftungsnetz, wirbelt hinein in meine kleine Höhle. Der Boden des Innenzeltes, mein Rucksack, mein Schlafsack – auf allem liegt eine dünne Staubschicht. Ich schmecke den Sand in meinem Mund. Er ist überall. Kein Entkommen. Es ist 2:40 Uhr. Die Nacht ist noch lang.
Der Wind scheint hier nie einzuschlafen, Heftige Böen wirbeln die Staubkörner der ausgedörrten kalifornischen Erde durch die Luft, Die äußere Plane meines Zeltes knallt und peitscht wie ein flatterndes Segel im Sturm. Ich kauere mich in meinen Schlafsack, lausche, hoffe und bete nach jeder Böe, dass sich auch der Wind schlafen legen möge. Doch jede Stille ist nur ein weiteres Einatmen. Meine Hüfte schmerzt auf der sich – kaum – selbstaufblasenden Isomatte, es zieht kalt in meinen Schlafsack und ich ziehe meine Windjacke über das Top, das längärmlige Tshirt und den Merinowollpulli. Weiter tobt der Sturm. Der Sand ist so fein, er dringt durch das Belüftungsnetz, wirbelt hinein in meine kleine Höhle. Der Boden des Innenzeltes, mein Rucksack, mein Schlafsack – auf allem liegt eine dünne Staubschicht. Ich schmecke den Sand in meinem Mund. Er ist überall. Kein Entkommen. Es ist 2:40 Uhr. Die Nacht ist noch lang.
Vor drei Monaten habe ich im Praktikum bei GEO über kalifornischen Nationalparks recherchiert. Dabei stieß ich auf den Channel Islands National Park vor der Küste von Los Angeles, der einzige maritime Nationalpark Kaliforniens. Die Bilder waren atemberaubend. Es gab keine andere Wahl: Da musste ich hin!
„It’s going to be rough out there!“ kommentiert die Frau am Ticketschalter von Islandpackers, dem Bootsunternehmen, meine Frage zu den Bedingungen auf dem Meer. Wie beruhigend. Für die frühe Stunde ist hier am Steg schon viel Betrieb, um die 100 Leute werden an Bord sein. Wir boarden um 8:00 Uhr. Locker flockig begrüßt uns die vierköpfige Crew, die Sicherheitsanweisung ist unterhaltsam, „Should you be so sick you need to feed the fish, please do so, but do it in the right direction“, auf den Wind verweisend. Ich knabbere an meiner Banane als wir in noch ruhigem Wasser aus dem Hafen auslaufen und bete, dass ich keine Fische füttern muss. „On this boat, it is easy to find the emergency exits: just anywhere you can fling your body over the railing“. Die Schwimmwesten heißen hier PFDs – Personal Floatation Devices. Und ein letzter Hinweis, „please do not lose your common sense, no playing King of the world“. Mit diesem Appell an den gesunden Menschenverstand verlassen wir das ruhige Fahrwasser, noch kurz bitte alle Hüte abnehmen, festhalten oder unter dem Kinn festzurren und dann brettern wir hinaus auf den wellenumwogten Pazifik.
Was folgt sind 3 Tage, 2 Nächte im Channel Islands National Park. Vor der Küste von LA liegen fünf Inseln, die den einzigen maritimen Nationalpark Kaliforniens bilden. Santa Rosa Island, das Ziel meiner Bootstour, ist die am zweitweitesten entfernte Insel, ca. 3 Stunden vom Ventura Harbor geht es nach Westen. Bis in die 1980er Jahren war Santa Rosa Island in privater Hand, eine amerikanische Familie ließ jahrzehntelang ihre Schafs- und Ziegenherden auf dem Eiland im Pazifik weiden. Seit der Nationalparkservice hier das Regiment übernommen hat, leben keine Menschen und Nutztiere mehr auf der Insel, die Vegetation soll sich erholen, wieder in den ursprünglichen Zustand gebracht werden. Die Inseln werden auch Galapagos der USA genannt, weil sich hier so viel endemische, also nur hier vorkommende, Flora und Fauna befindet. Nur ein paar alte Farmgebäude erinnern noch an den menschlichen Einfluss, doch diese Scheunen und Anwesen sind längst von Mäusekolonien eingenommen, sagt die Rangerin. Sie begrüßt und erklärt uns die Verhaltensregeln für den Park. Als wir auf Santa Rosa ankommen hat sich die Menschenmenge stark vermindert, der Großteil ist für einen Tagesausflug auf einer nähergelegenen Insel ausgestiegen. Übrig sind wir, um die 15 outdoor outgefitteten Rucksackträger mit Campingequipment. Eine Vierergruppe hat sogar zwei Surfboards dabei, wie sich später herausstellt sind Lizzy und Drew, Wylie und Will super sympathisch und ich verbringe einen Großteil der Inselzeit mit ihnen. Am Tage erkunden wir die Insel, die kleinen Trampelpfade, die durch kunstvoll geschliffene Canyons zu paradiesischen Strände oder durch einzigartige Pinienfelder führen. Wir geben kein Geld aus, aber sammeln Sanddollars. Tidepools laden zum Baden ein, solange der Lobster einen nicht zwickt. Und Lobster liegen hier überall am Strand, sind auf mysteriöse Weise verendet, genauso wie die zwei verwesenden Seelöwen auf die die Raben lauern. Knochen liegen hier überall, leider auch zu viel Plastik für eine so weit von der Zivilisation entfernten Insel. Wir finden Salzkristalle in einer Kuhle, Rob, der eine Brauerei in Carpenteria besitzt, nimmt eine kleine Menge mit, er wird damit Bier brauen. So hipster! Am zweiten Tag suchen wir einen Surfspot, Skunk Point, und werden auf dem Rückweg gesandstrahlt. Der Wind schlägt uns die Sandkörner um die Ohren, die Sandwiches zum Lunch werden zu Sandywiches, als wir wieder am Campingplatz ankommen sind wir völlig fertig. Surfen war unmöglich, die Strömungen mörderisch, aber das Wellenschauspiel beeindruckend.
Am letzten Tag habe ich kein Frühstück mehr, meine letzte Banane ist komplett zermatscht und die restlichen Nudel schmecken seltsam. Aber Lizzy und co. laden mich zu Oatmeal und Kaffee ein. Wir packen zusammen und schleppen unser zeug zurück auf den Steg. Ich bin so kaputt von der letzten Nacht und dem Marsch am gestrigen Tag, dass ich keine großen Wanderambitionen mehr habe. Nur eine kurze Tour auf einen nahegelegenen Hügel ist noch drin, dann schlafe und lese ich auf dem windgeschützten Steg bis das Boot ankommt. Wir legen um drei Uhr nachmittags wieder ab, als erstes brauche ich einen Schokoriegel! Wie schnell sowas zum hochgeschätzten Luxusgut werden kann. Drei Stunden Rückfahrt, dabei unternimmt der Kapitän mit uns einen kurzen Ausflug in eine massive Sea Cave (Seehöhle?!). Im Hafen von Ventura liegt das Abendlicht friedlich auf den Segelbooten, kein Windhauch kräuselt das Wasser. Endlich wieder Ruhe. Lizzy, Wylie und Drew – Will ist noch auf der Insel geblieben – nehmen mich mit dem Auto mit nach Ventura in die Stadt. Unser Hunger ist groß und wir stürmen das nächste Thairestaurant. Sechs Gerichte für vier Personen scheint angemessen. Wir schlemmen und sind viel zu schnell zu satt. Um halb zehn steige ich in den Zug zurück nach Santa Barbara. In der Vorfreude auf eine Dusche und ein Bett bei Gary und Steph, es gibt in diesem Moment kaum eine bessere Aussicht.















Info:
Eine geschichte, die alle Kalifornier in der schule lesen, spielt auf der Nebeninsel von santa Rosa, Santa Cruz Island: Island of the Blue Dolphins (http://www.nps.gov/chis/learn/education/island-of-the-blue-dolphins.htm)
Infos zum Channel islands National Park und Santa Rosa Island: http://www.nps.gov/chis/planyourvisit/santa-rosa-island.htm
Burgertasting. Und zwar „animal style“! Das ist der erste Geschmack Santa Barbaras. Wenn ich so über die Reise nachdenke, dann habe ich bisher tatsächlich erst ein oder zwei Burger gegessen. Ganz amiuntypisch! Also reingehauen. Erst bei In n‘ Out den animal style (ein Relish mit süßsauren Gurken, das steht nirgendwo dran – reines Insiderwissen!) Burger und animal style Pommes, ein paar Tage später ‚muss ‚ ich dann auch noch den Burger bei The Habit probieren. Der ist noch besser, mit kandierten Zwiebeln! Aber genug des Fastfoods…
Santa Barbara, das ist die Riviera Südkaliforniens, das „pleasantville“ des Golden State. Für mich ist es die Geschichte von Billy, dem Obdachlosen. Aber dazu später. In einer lokalen Zeitung lese ich, dass 60% der Mieter in Santa Barbara mehr als 1/3 ihres Einkommens für ein Dach über dem Kopf zahlen, 33% blechen sogar mehr als die Hälfte ihres Einkommens. Die Rede ist von einer Paradiessteuer, „paradise tax“ – the added cost of living along the South coast“. Das hier alles schickilacki ist fällt auch sofort auf, besonders weil ich vorher die Großstadt LA vor und in der Nase hatte. Apropos Großstadt: Die Busfahrt von LA nach Santa Barbara war wieder abenteuerlich. In der Greyhound Bus Station in Long Beach, CA ist der Bus schon über eine Stunde verspätet – ich warte seit 2,5 Stunden, weil ich schon früh aus dem Hostel aufgebrochen bin. Und ich warte nicht alleine: Da ist Aaron, der Soldat, der gerade von einer Beerdigung kommt und in ein paar Stunden von Las Vegas wieder nach Afghanistan fliegt. Da ist ein Haufen ungebändigter Kinder, die sich kreischend gegen den Süßigkeitenautomaten werfen und, als der keine Schokoriegel herausrückt, anfangen sich gegenseitig zu erwürgen. Drei ältere Damen mit chinesischem Antlitz unterhalten sich gedämpft auf Spanisch während sie das Treiben beobachten und dann ist da dieser alte Mann mit Hut. Ich weiß nicht, ob er besoffen oder einfach ein bisschen bekloppt ist, oder beides. Auf jeden Fall schreit und lallt er. Dabei klopft er immer wieder seinem halbstarken Sohn auf die Schulter. Der schleift genervt seinen Ziehkoffer ohne Rollen (!) hinter sich her, als er grinst blitzt Gold hervor, edle Schneidezähne! Als der Bus endlich eintrifft weigert der Alte sich ihn zu umarmen, „we don’t hug! we don’t hug!“, der Sohn verabschiedet sich mit Handschlag und einem demütigen „Bye, Sir“.
Santa Barbara empfängt mich mit offenen Armen, beziehungsweise sind es Gary und Steph die ihre Arme ausbreiten. Die Nummer auf der Serviette vom Nashville Airport ( http://www.blogmopped.com/2015/07/29/nashvegas/) erweist sich als goldwert, sie wandelt sich zu einer riesige Luftmatratze und einer noch größeren Portion Gastfreundschaft. Gary und Steph sind Geschwister, zwei von sieben, die in Santa Barbara aufgewachsen sind und noch immer hier leben. Bei ihnen im Wohnzimmer darf ich die nächsten Nächte meinen Schlafsack ausbreiten, duschen und mich wie zu Hause fühlen. Dabei hat mich eigentlich nur reine Zweckmäßigkeit nach Santa Barbara geführt. Nicht weit von hier, von Ventura, fährt das Boot hinaus zu den Inseln des Channel Islands National Park, mein eigentliches Ziel. Bis zu meinem Aufbruch sind es noch 2 Tage. Genug Zeit, um Santa Barbara zu erkunden. Vielleicht treffe ich ja Alfred Hitchcock, oder Justus, Bob und Peter? Existiert Rocky Beach eigentlich wirklich? Ich fahre mit dem Bus in die Stadt, die ständige Hintergrundkulisse der Stadt sind die Hügel des Los Padres National Forest. Und natürlich sind da die Palmen, die ihre langen schlanken Hälse wie Giraffen aus dem Cluster der Straßen emporstrecken, ein unverkennbares Merkmal Kaliforniens. Ich spaziere die schicke State Street entlang, alles blitzt, niedliche Läden reihen sich aneinander, die Stadt versprüht das Flair eines unbesorgten Sommerurlaubes. Bevor die Straße auf den bekannten Pier mündet brauche ich dringend einen Kaffee. Im Coffeeshop redet ein alter Mann mit der Kassiererin und während ich meinen Cappuccino bestelle wedelt er mit einer Postkarte auf der in großen Zahlen eine Telefonnummer geschrieben steht. Die Kassierin reicht ihm ihr Handy, offenbar kennen sie sich schon länger. Er witzelt über irgendwelche Geheimdienste, sagt er sei von der NSA und beide kiechern, „Oh Billy“, sagt sie kopfschüttelnd. Ich bekomme meinen Kaffee, setze mich draußen an einen Tisch und beginne Postkarten zu schreiben. Neben dem Nachbartisch hat jemand eine Art Einkaufswagen geparkt, eher Modell Hackenporsche, aber aus einem Drahtkorb, sodass ich den Schlafsack und die Decken sehen kann, die darin gestapelt sind. Zwei Minuten später lässt Billy sich auf den Stuhl neben mich plumpsen, greift eine Plastiktüte vom Deckenstapel im Korb und beginnt ein Subway Sandwich auszuwickeln. Er hat weißes Haar, das unter seiner schmutzigen Cap hervorschaut. Aus den Ohren wachsen ebenfalls kleine weiße Büschel, weiße Stoppeln im wettergegerbten Gesicht eines alten Mannes. Er trägt Shorts und ein kurzärmeliges Hemd, das bis zur Mitte der Brust aufgeknöpft ist – vielleicht fehlen aber auch die Knöpfe, ich kann es nicht erkennen. Auch die Arme und Beine sind sonnengebräunt, die Haut ledrig. Die Füße in Socken und Sandalen. Billy ist dünn, aber nicht abgemagert, eher zäh wie ein alter Opa, nur ein ganz kleines Bäuchlein ist übrig geblieben. Er sieht ordentlich aus, riecht nur ein bisschen ungewaschen, aber nicht aufdringlich. „Do you want this Subway Sandwich?“ fragt er und hält mir lächelnd das gefüllte Wrap entgegen. Seine Augen! Sie sind milchig, er fokussiert mich nicht beim Sprechen. „Oh, no thanks, I’m good, but thanks“ erwidere ich schnell. „You know I can’t really see. I see your teeth, you are smiling, I can see that. But I don’t see your eyes.“ Ich beobachte ihn wie er die Plastiktüte des Sandwiches ordentlich faltet, wenig später bläst der Wind sie vom Tisch. Er bemerkt es nicht, ich hebe sie auf, er bedankt sich und schiebt sie zwischen die Decken in seinen Korb. Auf der Suche nach Servietten greift er in die Tasche einer abgewetzten Lederjacke, früher habe er viele teure Sachen wie diese Jacke gekauft sagt er. Zu dieser Zeit haben wir uns bereits zwanzig, vielleicht dreißig Minuten unterhalten, meine Postkarten liegen halb beschrieben auf dem Tisch, mein Kaffee halb ausgetrunken längst kalt und vergessen. Billy erzählt von seinen Reisen, nach Asien und Europa. Als ich ihm erzähle ich komme aus Hamburg und schon ansetzen will zu erklären wo das in Deutschland liegt, fragt er bereits nach dem großen Hafen. Die Art wie er sich ausdrückt, das Wissen was er hat – er ist sehr schnell klar, dass Billy alles andere als ungebildet ist. Und doch sitzt er hier mit seinem Karren und ist ganz offensichtlich obdachlos. Ich kann nicht anders, ich muss ihn fragen: „Billy, may I ask you this“, beginne ich, vorsichtig und höflich, es ist mir ein bisschen unangenehm, ich weiß nicht wie er reagieren wird, „Why don’t you have a home? What happened to you?“ Er lächelt mich an, „You want me to tell you my story?“ Yes! Und so beginnt es, wir sitzen weitere zwei Stunden auf den Stühlen des Kaffees, Menschen strömen vorbei in der warmen Mittagssonne Santa Barbaras, manche schauen uns seltsam an. Er erzählt, ich höre zu, frage hier und da nach. In der Kurzfassung: Billys Leben ist nie ein standhaftes gewesen. Er wuchs in Nordtexas auf, heiratete mit 19, doch die Ehe hielt ein paar Jahre, danach lebte er alleine, hier und da eine Beziehung, nichts ernsthaftes. Nach dem College führten ihn verschiedene Jobs überall hin, „I technically lived everywhere in the States“. Billy ist ein Geschichtenerzähler, ich bin mir sicher er schmückt einiges aus, aber er wirkt nicht verrückt, all das scheint glaubhaft, Er arbeitete als Maler, als Fliesenleger, war Folksänger und Gatekeeper, einmal für ein paar Jahre auch professioneller Termiteninspektor für die Stadt LA. Und zwischendurch stopfte er Tiere aus, für Sammler. Er hatte immer Arbeit, immer Geld. Vor allem auch Zeit um zu reisen. Mit 40 ging er nach New Orleans, begann dort für eine vermögende Frau Immobilien zu verwalten und in Stand zu halten. Sie vermachte ihm in dieser Zeit ein altes Haus, heruntergekommen und leerstehend. Er sollte er herrichten und für sich selbst nutzen. Billy steckte eine Menge Arbeit, Sorgfalt und Geld in das Projekt, seine Altersvorsorge, sein Platz für den Lebensabend. Zwei Tage vor der Fertigstellung seines Hauses traf Hurrikane Katrina New Orleans. Das war 2005. Ab dann ging es bergab. Ein paar Jahre in Austin Texas, dort brachten ihn die Rettungskräfte hin, ein Job als Eisenbahnfahrer für Kinder in einem Freizeitpark, mit 62 der einzige Job den man ihm noch anbot, eine günstige kleine Wohnung in einem Hochhauskomplex in einem internationalen Viertel, „my neighbors were all Mexicans, lovely people“. Dann kamen die Investoren, kauften die Häuser und hoben die Miete um mehr als 400 Dollar. Heute ist Billy 72 und lebt auf der Straße in Santa Barbara. Er erhält ein bisschen Sozialgeld, aber für eine Wohnung reicht das nicht. Die Obdachlosenshelter gefallen ihm nicht, er schläft lieber in einem Park. Gestern Nacht ist sein Schlafsack nass geworden, weil die Sprinkleranlage plötzlich losging. Er lacht als er das erzählt, er sollte es mittlerweile wissen, sagt er. Er steckt sich den Rest Subway Sandwich in den Mund, wischt mit den Servietten die Mundwinkel sauber. „Do you want desert? These cookies are really good, they put this cream in them, vanilla I believe.“ Ich erkenne die Plastikverpackung des 99 cent stores in dem ich ein paar Vorräte für meinen Inseltrip gekauft habe. Er zeigt mir seine Essenskiste, ein schuhkarton mit Keksen, Scheibletten Käse und zwei Pakete Yum Yum Nudeln, alles akkurat einsortiert. Ich schüttle wieder den Kopf, mein Herz wird immer schwerer. Dieser alte Mann ist so gutmütig, kein Stück verbittert, trotz seines Schicksals. „You can get good Fish n‘ Chips out on the pier, you know, the Moby Dick Place, it’s not expensive.“ Das werden die nachdenklichsten Fish n‘ Chips, die ich jemals gegessen habe. Die Begegnung sitzt mir in den Knochen. Als ich gehe habe ich einen Kloß im Hals und in Billys milchigen gutmütigen Augen meine ich spiegelt sich eine Träne. Wir wissen beide, dass wir uns nicht wiedersehen. Dass diese Stunden eine besondere Begegnung waren, die bald nur noch eine Geschichte sein wird. Für mich die Geschichte eines Schicksals, ich werde nicht erfahren was mit Billy passiert. Seine Geschichte geht mir nahe, ich empfinde eine grausame Hilflosigkeit, ich kann nichts tun um ihm zu helfen. Nur zuhören. Santa Barbara ist seit dem für mich die Geschichte von Billy, the homeless guy. Später erzähle ich Gary und Steph von meiner Begegnung. Gary, der als Rettungssanitäter in der Stadt arbeitet und viele Obdachlose sogar beim Namen kennt, meint Billy zu kennen. Ein Unfall vor ein paar Monaten, Billy sei einfach über die Straße gelaufen. Ein Beinbruch, ich erinnere dass Billy so etwas erzählt hat. Armer alter Mann.
Ich packe meinen Rucksack und verlasse Santa Barbara für drei Nächte, um den CINP zu erkunden (https://blogmopped.com/2015/08/05/rough-and-remote-stormy-and-sandy-santa-rosa-island-ca/). Ein paar Sachen kann ich hier in der Wohnung lassen. Bei meiner Rückkehr gewähren mit Gary und Steph weitere zwei Nächte Unterschlupf. Ich bin so dankbar für diese bedingungslose Gastfreundschaft. Am letzten Abend erzählt Steph (Gary muss leider arbeiten) mir bei Lasagne und Rotwein – zumindest ein Versuch mich für die Gastfreundschaft zu bedanken! – die Geschichte hinter ihrem Nashville Ausflug: Die Beerdigung ihres Großvaters. Er hatte immer ein offenes Haus für Fremde und Reisende, „open door policy“, sagt Steph. Vielleicht war Garys Impuls mir die Nummer aufzuschreiben daher gekommen. Sie sagt, dass nachdem ich angekommen bin, Gary und sie sich angesehen und gegrinst haben, „Aren’t we the grandchildren of our grandfather?“. Mir gefällt die Geschichte. Alles ist Zufall und doch alles verknüpft. Dass sich in dieser Situation unsere Wege kreuzten, manche Dinge kann man einfach nicht planen.





 Thank you, Steph and Gary!
Thank you, Steph and Gary!
Müdigkeit und Hitze – kein gutes Duo. Deshalb habe ich die eintägige Stippvisite in Nashville heute noch erheblich weiter verkürzt. Um 9:30 Uhr rollte der Greyhound in Nashville ein. Nach vier Stunden war für mich schon wieder Ende Gelände, Stadtbummel bei 38 Grad ist heißer als ein Höllenbesuch. Ursprünglich hatte ich geplant einige Tage in der Stadt zu verbringen, um dem Country Vibe so richtig auf die Rhythmen zu fühlen. Aber dann wirkte das plötzlich vor ein paar Tagen doch nicht mehr so attraktiv: teure Unterkünfte, heiße Tage, alleine Bars besuchen und überhaupt Stadt statt Natur. Nö, keine Lust. Der Bus war schon gebucht, ich habe einfach einen Flieger drangehängt: Nashville – Los Angeles. Trotzdem, ein tag in der Stadt der Country Größen sollte drin sein.
Nun, ich kann nicht behaupten die Leuchtschriften im Dunkeln gesehen, das Nachtleben erkundet und die wirkliche Szene der Stadt erlebt zu haben, aber ein bisschen reingeschnuppert habe ich dennoch. In der selbsternannten Music City dringen nämlich auch schon am Vormittag aus den Honky Tonk Kneipen Gitarrensounds und Mundharmonikaharmonien. Die Bars tragen Namen wie Tin Pan Alley oder Legends Corner. Sie sind hier alle schon aufgetreten, Johnny Cash, Dolly Parton bis hin zu Taylor Swift. In Tin Pan Alley (übrigens nach einer Strasse in New York benannt, in der sich Musikproduzenten ansiedelten) bestelle ich eine Sprite – ein Eimer von Getränk! – und lausche bekannten Melodien. Der junge Sänger auf der Bühne hat einen Südstaatenakzent auf den Lippen und covert die alten und neuen Stars, bei „Ring of Fire“ könnte auch Johnny auf dem Stuhl sitzen, der Junge ist gut! Die Stadt kommt auch im Falle des Merchandising ihrem Ruf nach. Es reiht sich ein Cowboystiefel Laden an den nächsten, ein Hard Rock Cafe ist selbstverständlich vertreten, genauso wie die Restaurants, die vorwiegend southern food anbieten. Ich starte in den Tag mit knusprigem Bacon, Rührei und einer weißen, mehligen Gravy Sauce, für die ich mich allerdings so gar nicht begeistern kann. Auf den Straßen laufen Mädels in knappen Jeansshorts und Cowgirlboots, die beides lieber nicht tragen sollten, und solche, die man sich in dem Outfit direkt auf dem rotierenden Bullen vorstellen kann. Touristen bevölkern die Straßen, sie sind alle nur wegen der Musik gekommen. Nashville wird schon nicht ohne Grund auch „Nashvegas“ genannt. Ein absolut monothematischer Besuchermagnet, diese Country Musik. Ich habe es live gesehen, das reicht mir für heute und den bunten Fleck auf der mind map.






 Und dann noch ein bisschen Heimathafengefühle, wie schön!
Und dann noch ein bisschen Heimathafengefühle, wie schön!
15 Stunden, so lange darf ich es mir am Flughafen in Nashville gemütlich machen. Mein Flieger nach LA geht morgen früh um 5:30 Uhr. Ein erster Hoffnungsschimmer als ich die Abflughalle betrete: Teppichboden! Außerdem nicht schockgefrostet, sondern angenehm temperiert. Auch hier liegt noch Country Musik in der Luft, eine junge Frau namens Cory sitzt am Klavier und singt melancholisch schöne Lieder von verflossener Liebe und alkoholexzessen, country eben. Ich höre ihr eine Weile zu, dann widme ich mich den vernachlässigten Pflichten: Ich leite meine lange Wartezeit mit einer notwenigen Körperhygiene in den öffentlichen Toiletten ein, sprich: Zähne putzen und Füße waschen. Dabei schaut mich die facility managerin nicht sehr begeistert an, ich störe eindeutig ihre Putzroutine…
Los Angeles also. Kleine Planänderung meines mentalen Reisekonstruktes. Ab morgen hänge ich Deutschland dann neun Stunden hinterher. Ich fliege zurück, vor allem zurück an die Küste, damit ich nach den Sonnenaufgängen an der Ostküste endlich die Sonne wieder im Meer versinken sehe. Ein rundes Ding. Ein ewiger Kreis. Hakuna Matata.
BECAUSE THESE THINGS JUST KEEP HAPPENING WHEN YOU TRAVEL….was war geschehen? Folgende Situation: ich sitze seit 2 Stunden am Flughafen von Nashville, fegt ein heftiges Gewitter über das Gelände hinweg, ein Blitz legt für 3 Sekunden die Elektrizität des Flughafens lahm. Stromausfall, power out. Ich denke mir nichts dabei, mein Flug geht ohnehin erst morgen früh, ich verziehe mich in eine Ecke der Abflughalle, schlafe, gammle, lese und so weiter. 19 Uhr, langweilig, Hunger! Mit einem überteuerten Starbucksbagel (Flughäfen sind Tankstellen, Wucher!) lasse ich mich an einem Tisch neben drei Amis nieder. Wie das so läuft, wir kommen locker ins Gespräch. Der Typ fragt mich, ob mein Flug auch gecancelt wurde. Ich winke ab, ich habe noch ewig Zeit, aber gecancelt? Wegen des Stromausfalls? Er nickt, über Denver wollten sie nach Los Angeles fliegen. Aha, voila, das ist ja auch meine Destination! So redet man weiter und weiter und es stellt sich raus, dass die drei in Santa Barbara leben, also um die Ecke von LA nur schöner. Und ganz dicht am Channel islands National Park!! Bevor sie losziehen, um die Nacht bei Verwandten (statt wie ich am Flughafen) zu verbringen, habe ich das hier auf dem Tisch. Melde dich, wenn du in der Gegend bist!, sagt Gary. Einfach nur genial, mal wieder sprachlos…
Von Washington D.C. nach Nashville, Tennessee. 666 Meilen (etwa 1072km). A hell of a ride: meine erste Fahrt im Greyhound Bus. Mit der Betonung auf HELL…
Von Washington DC nach Charlottesville, VA lief noch alles entspannt. Ein ordentlicher Bus, wenig Passagiere, demnach der Luxus eines doppelten Sitzes. Aber dann ging es los. Umstieg. Der neue Bus ist schon über eine Stunde verspätet. Als er um halb 11 nachts in Charlottesville eintrifft sind fast alle Plätze schon besetzt. Wir, die zusteigen, füllen seine schäbbigen Ledersitze restlos auf. Oh Gott, 11 stunden Busfahrt vor mir und neben wem soll ich sitzen? Da ist die wippende Frau, die mit dem Oberkörper immer wieder nach vorne und hinten schaukelt, ein ganz unangenehmer Tick. Da ist das unheimliche Kind, ein Junge mit vernarbtem Gesicht, der auf seinem Handy hektisch Ballerspiele zockt. Ein alter ungepflegter Mann, kaum noch Haare aber ein head set auf dem Kopf mit Mikrofon vor dem Mund (er trägt es die ganze Fahrt ohne zu telefonieren). Die Mexikanerin, die den Tränen nahe ist und panisch versucht in ihrem nicht vorhandenen Englisch mit dem Buspersonal ihre Route zu ändern (sie muss ganz bis Arizona), weil sie Angst hat in El Paso auf Dokumente kontrolliert zu werden, die sie nicht hat. Ganz unangenehm: die aufgedunsene Frau mit den strähnigen grauen Haaren und einem Körpergeruch, den die Klimaanlage durch die Luft wirbelt.
Unter all diesen Optionen ist ein Strohhalm, den ich geistesgegnwärtig ergreife: Ein junger Mann, der eingeschlafen ist und seinen Rucksack auf dem Sitz neben sich stehen hat. Der sieht harmlos aus! Ich rüttle leicht an seiner Schulter, er macht sofort Platz und ich atme auf. Uh, bäh, der Körpergeruch in meiner Nase! Der strähnige Kopf ragt über den Sitz vor mir hinaus. Mein Atem wird flacher, nur für ein paar Stunden, immerhin nicht neben mir.
Bis 1 uhr nachts bleibt das so, recht entspannt, nur die Sitze sind krass unbequem. Genau am rücken vorbeikonstruiert! Dann muss mein Sitznachbar leider aussteigen. Neben mir ein freier Platz. Und natürlich steigt dafür jemand ein, damn it. Eine Wolke aus Nikotin umgibt mich bevor er sich überhaupt gesetzt hat. Ich habe ihn draußen vor dem Bus schon stehen gesehen, mit der Fluppe im Mund, und dachte Bitte, Bitte nicht! Er, der sich später als Chris aus Texas vorstellt, ist eigentlich ganz nett, aber auch ein bisschen sehr vereinnahmend und distanzlos. Die mittlere Armlehne gehört schon mal ihm (wem gehört die eigentlich?). Und im Schlaf rutscht sein Ellenbogen immer wieder ab, sodass sein Kopf halb auf meiner Schulter landet. Ich neige mich so weit es geht zum Fenster. Oh man, noch 7 Stunden….In the middle of nowhere Sodom und Gomorrah aus, der ganze Himmel ist von den Blitzen taghell erleuchtet, der Donner kracht und Regen trommelt aufs Dach. So hart anscheinend, dass im hinteren teil des Busses plötzlich Wasser durchsickert. Es tropft von oben und bald ist auf dem Boden eine Pfütze. Den Fahrer interessiert das herzlich wenig, mürrisch tritt er auf das Gas und ich hoffe sehr, dass er bei der Sturzflut und dem Tempo mehr von der Straße sieht als ich. mein iPhone schickt mir eine flash flood Warnung. Meiden Sie das Gebiet. Haha, sehr witzig! Irgendwann lässt der Regen nach, ein letzter heller Blitz und in dem Moment schaue ich aus dem Fenster, zwischen den Bäumen am Straßenrand ein großes Schild, „JESUS WILL COME SOON“. Jetzt geht es aber los!
Endlich, in einer absurden Haltung und völlig verspannt, aber: eingeschlafen! Schmeißt man uns um 5 Uhr gnadenlos mit Licht an und Everybody out! zweisilbig unfreundlich aus dem Bus. Wir sind in Knoxville. Schon Tennessee, circa drei Stunden östlich von Nashville. Alles Kotzbrocken hier, das Greyhound Personal behandelt uns wie Abschaum. Keiner erklärt was los ist, aber wir müssen alle raus, 20 Minuten warten, und dann alle wieder rein. Die neue Busfahrerin ist ein pedantischer Drachen, der uns herumkommandiert und zurechtweist. Sie macht klipp und klar deutlich welche Regeln in IHREM Bus gelten. Neben Rauchen ist auch Küssen und lautes Handyklingeln ein Grund aus dem Bus zu fliegen. Mein Nachbar Chris murmelt „she takes her job way too serious…“. Dann erreichen wir tatsächlich Nashville. Ich rolle den Schlafsack zusammen (wie Hechtsuppe, diese Klimaanlagen!) und mache mich aus dem Staub. Bin ich froh, dass ich nach LA fliege!
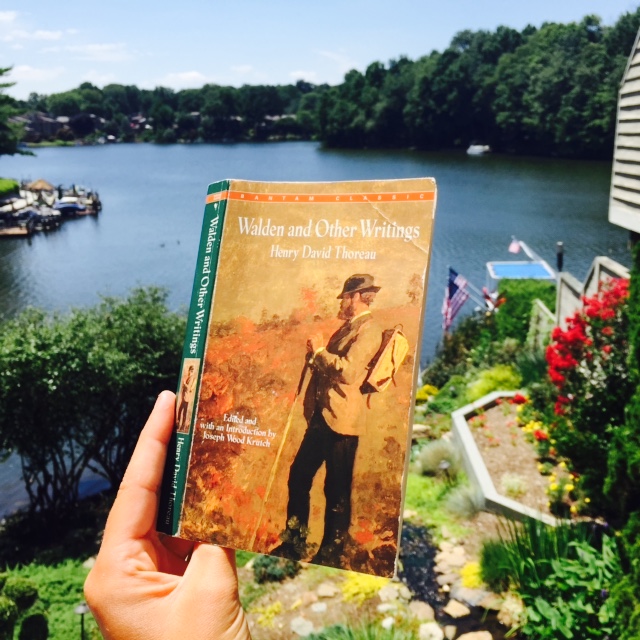 „Isn’t that funny!“ Jeder Mensch hat seine bestimmten sprachlichen Wendungen, die er oder sie häufig benutzt. Eine Art Kommunikationsmerkmal, ich sage beispielsweise ständig „ach krass!“, um eine Aussage zu kommentieren, und dann ist da dieses Wort „mega“, was sich seit einiger Zeit in meinen Wortschatz eingeschlichen hat. Die charakteristische Wendung von Shirley, der Nachbarin meiner housesitting hosts Gil und Liz, ist ein „Isn’t that funny?“, mit einer starken betonung auf dem u. Eine herzensgute 70jährige Dame, die aber noch durchaus agil ist – ihr acht Monate junger Riesenwelpe Houdik haelt sie auf Trab! Ihrem Aussehen nach muss sie japanische Wurzeln haben, geboren ist sie jedoch auf Hawaii. Ihre Erzaehlungen verraten, dass sie schon fast ueberall auf der Welt gewesen ist. Bald geht es los in die Rocky Mountains, naechstes Jahr stehen die Dolomiten auf dem Reiseplan. Galapagos ist noch nicht lange her. Lebenslaeufe! Shirley nimmt mich am Sonntag Morgen mit auf den See. Ihr Pontoon Boat vor dem Haus ist eine Art schwimmende Terrasse, eine viereckige Plattform, die fuer ein Boot etwas zu unfoermig daherkommt. Aber sie schwimmt. Unter geraeuschlosem Elektromotor schippern wir gemaechlich hinaus. Der See? Lake Thoreau. Wieder einer dieser Zufaelle, die auf Reisen einfach passieren und mich kurz sprachlos dastehen lassen. Benannt nach dem amerikanischen Naturalisten und Schriftsteller, Henry David Thoreau, liegt dieser See also genau vor meiner Nase, beziehungsweise mein zu sittendes Haus sitzt direkt an seinem Ufer. Wie das Schicksal es so will, habe ich auf diese Reise nur ein einziges Buch mitgenommen, Backpack und Buecher verTRAGEN sich schlichtweg nicht und auf ein kindle wollte ich verzichten. So habe ich also ein Buch ausgewaehlt, welches, wie sollte es anders sein, natuerlich WALDEN von Henry David Thoreau ist. Und dann lande ich hier, per Zufall, am Lake Thoreau. Natuerlich ist es nicht DER Walden Pond. Der „richtige“ Walden Pond, an dem Thoreau 2 Jahre im Wald verbrachte, liegt in Massachusetts. Und vermutlich haette Thoreau hier in Reston sofort die Flucht ergriffen, denn Lake Thoreau wurde kuenstlich gebaut, um die Wohngegend hier zu entwickeln. Der Bebauungsplan sieht fuer fast jedes Haus am See eines dieser Pontoon Boote vor, wie Shirley eines hat. Die ganze Gegend hier ist ein geplantes Konzept, wohnen am (kuenstlichen) Gewaesser. Thoreau als Freund von unberuehrter Natur und selbsternannter Anti-Materialist wuerde sich im Grab umdrehen, wuesste er, dass diese domestizierte und kapitalistisch motivierte Badewanne nach ihm benannt ist. Er saehe sein „The mass of men lead lives of quiet desperation.“ vermutlich in diesem Konzept bestaetigt. Dennoch, es ist ein lustiger Zufall, der See und mein Buch. Und so aufgesetzt wirkt das Leben hier gar nicht, nur ein bisschen konstruiert idyllisch vielleicht. Ich jedenfalls haette nichts gegen ein Stegboot im Garten, einen See in dem wilde (…) Schildkroeten leben und in dem schon morgens frueh Stand Up Paddeler ihre Runden ziehen und Triathlethen trainieren.
„Isn’t that funny!“ Jeder Mensch hat seine bestimmten sprachlichen Wendungen, die er oder sie häufig benutzt. Eine Art Kommunikationsmerkmal, ich sage beispielsweise ständig „ach krass!“, um eine Aussage zu kommentieren, und dann ist da dieses Wort „mega“, was sich seit einiger Zeit in meinen Wortschatz eingeschlichen hat. Die charakteristische Wendung von Shirley, der Nachbarin meiner housesitting hosts Gil und Liz, ist ein „Isn’t that funny?“, mit einer starken betonung auf dem u. Eine herzensgute 70jährige Dame, die aber noch durchaus agil ist – ihr acht Monate junger Riesenwelpe Houdik haelt sie auf Trab! Ihrem Aussehen nach muss sie japanische Wurzeln haben, geboren ist sie jedoch auf Hawaii. Ihre Erzaehlungen verraten, dass sie schon fast ueberall auf der Welt gewesen ist. Bald geht es los in die Rocky Mountains, naechstes Jahr stehen die Dolomiten auf dem Reiseplan. Galapagos ist noch nicht lange her. Lebenslaeufe! Shirley nimmt mich am Sonntag Morgen mit auf den See. Ihr Pontoon Boat vor dem Haus ist eine Art schwimmende Terrasse, eine viereckige Plattform, die fuer ein Boot etwas zu unfoermig daherkommt. Aber sie schwimmt. Unter geraeuschlosem Elektromotor schippern wir gemaechlich hinaus. Der See? Lake Thoreau. Wieder einer dieser Zufaelle, die auf Reisen einfach passieren und mich kurz sprachlos dastehen lassen. Benannt nach dem amerikanischen Naturalisten und Schriftsteller, Henry David Thoreau, liegt dieser See also genau vor meiner Nase, beziehungsweise mein zu sittendes Haus sitzt direkt an seinem Ufer. Wie das Schicksal es so will, habe ich auf diese Reise nur ein einziges Buch mitgenommen, Backpack und Buecher verTRAGEN sich schlichtweg nicht und auf ein kindle wollte ich verzichten. So habe ich also ein Buch ausgewaehlt, welches, wie sollte es anders sein, natuerlich WALDEN von Henry David Thoreau ist. Und dann lande ich hier, per Zufall, am Lake Thoreau. Natuerlich ist es nicht DER Walden Pond. Der „richtige“ Walden Pond, an dem Thoreau 2 Jahre im Wald verbrachte, liegt in Massachusetts. Und vermutlich haette Thoreau hier in Reston sofort die Flucht ergriffen, denn Lake Thoreau wurde kuenstlich gebaut, um die Wohngegend hier zu entwickeln. Der Bebauungsplan sieht fuer fast jedes Haus am See eines dieser Pontoon Boote vor, wie Shirley eines hat. Die ganze Gegend hier ist ein geplantes Konzept, wohnen am (kuenstlichen) Gewaesser. Thoreau als Freund von unberuehrter Natur und selbsternannter Anti-Materialist wuerde sich im Grab umdrehen, wuesste er, dass diese domestizierte und kapitalistisch motivierte Badewanne nach ihm benannt ist. Er saehe sein „The mass of men lead lives of quiet desperation.“ vermutlich in diesem Konzept bestaetigt. Dennoch, es ist ein lustiger Zufall, der See und mein Buch. Und so aufgesetzt wirkt das Leben hier gar nicht, nur ein bisschen konstruiert idyllisch vielleicht. Ich jedenfalls haette nichts gegen ein Stegboot im Garten, einen See in dem wilde (…) Schildkroeten leben und in dem schon morgens frueh Stand Up Paddeler ihre Runden ziehen und Triathlethen trainieren.
„In order to keep a true perspective of one’s importance, everyone should have a dog that will worship him and a cat that will ignore him.“
(Dereke Bruce)
Samson hat mich weder zu sehr ignoriert, noch hat Clay mich über alle Maßen verehrt…obwohl, bei Punkt zwei bin ich mir nicht ganz so sicher. Clays tappende Pfoten auf dem Parkettboden waren gefühlt mein ständiger Begleiter, und dazu dieser Blick! Ihm ging es dabei wohl nicht wirklich um mich, das muss ich mir eingestehen, sondern um eine andere, für seine Welt alles entscheidende Sache: Futter!
Mal wieder hat es das Reiseschicksal gut mit mir gemeint. In den USA hat man ein Herz für junge, finanzschwache Backpacker. New York, New Jersey, Virginia Beach – überall habe ich bisher nichts als Großzügigkeit genossen. Hier in Reston bei Washington D.C. übernehmen Liz und Gil die Rolle der liebevollen Gastfreunde. Dafür tue ich allerdings diesmal auch etwas: Ich spiele House- und Petsitter. Das heißt so viel wie ich passe für ein paar Tage auf das Haus, eigentlich aber eher auf ihre beiden ‚Jungs‘ auf: Samson, der Kater und Clay, der Hund (ein Rat Toy Terrier, eigentlich also eher Ratte als Hund, aber so süß!).
Das Haus ist ein Traum. Direkt am See gelegen führt der Garten hinunter an einen kleinen Steg mit Terrasse auf dem Wasser. Wilde Schildkröten strecken ihre Köpfe aus dem Wasser, Boote schippern gemächlich hin und her und gleich am ersten Abend sitze ich mit Gil und Liz bei Weißwein und Sonnenuntergang auf dem Balkon. Die warme Nachtluft schmeichelt der Haut, fast ein bisschen Balifeeling. Ich fühle mich hier sofort willkommen. Weniger willkommen sind die Gänse des Sees, das lerne ich schnell als Gil, die Arme über dem Kopf wild gestikulierend und laut schimpfend, auf den Steg zu rennt, um die ungebetenen Gäste von der schwimmenden Terrasse zu verscheuchen. ‚Kaka‘ nennt Gil die Exkremente die sie zurücklassen, das klingt fast niedlich. Gänse sind hier also die Maulwürfe, die Oma in Deutschland im Garten in den Wahnsinn treiben. Gill hat ein anti-geese-spray gekauft, das verteilt er auf dem Holz des Steges – zehn Minuten später sind sie wieder da und machen ‚Kaka‘ auf das Holz. Was solls…Als wir abends auf dem Sofa sitzen und einen Klassiker, „Ghostbusters“, schauen, ist uns ganz schnell klar: Liz und Gill brauchen die „Goosebusters“ !!
Dann sind wir alleine, Samson, Clay und ich – und wir machen es uns richtig gemütlich. Vier Tage sturmfrei. Ich habe gar keine Lust nach Washington zu fahren (nur einmal kurz hat es mich ins Museumsviertel verschlagen) oder das City Center von Reston zu erkunden – dieses Fleckchen Erde reicht mir gerade völlig. Außerdem bin ich beschäftigt: Nie hätte ich gedacht, dass Tiere einem so sehr den Tag strukturieren. Aber mit Gassi gehen, füttern und Medizin verabreichen und das alles mehrmals am Tag ist man ganz gut beschäftigt. Vor allem immer zu bestimmten Uhrzeiten. Aber es macht mir Spaß und es ist schön zu sehen, wie sehr die beiden Jungs an ihre Routine gewöhnt sind. Clay rennt morgens und nachmittags immer wie verrückt um die freistehende Arbeitsplatte in der Küche – ist schon Essenszeit?, fragen seine großen, wimpernlosen Augen. Die freien Zeitfenster neben Gassi und Fresschen nutze ich um zu lesen, meinen Trip zu planen, ein bisschen um den See zu laufen und zu schlafen. Da es für Samson und Clay sowieso nicht viel anderes als schlafen und fressen gibt stecken sie mich mit ihrem fast konstanten Chillmodus an, hier ein Vormittagsschläfchen, da ein Nachmittagsnap. Clay gibt übrigens keine Ruhe, bis er zu mir aufs Bett und dort mit mir einschlafen darf. Aiaiaiai, aber ich denke das ist okay. Wie früher eben, wenn die Eltern mal nicht da waren – dann darf man immer mehr.
Ich selbst will glaube ich immer noch keinen Hund oder eine Katze. obwohl das strukturgebende Element vielleicht gar nicht so schlecht wäre, besonders in Zeiten des Hausarbeitschreibens. Aber an die Haare auf dem Boden, auf der Hose und dem Sofa, an die Abhängigkeit und an ‚Kaka‘ in schwarzen Plastikbeutelchen mag ich mich glaube ich auf Dauer nicht gewöhnen. Wenn, dann bin ich, zu meiner eigenen Überraschung, doch eher eine ‚cat person‘. Samson machte wenigstens auch mal sein eigenes Ding.
Was noch? Ich habe gelernt, dass Herrchen und Frauchen auf Englisch schlicht ‚Dad and Mom‘ heißt. Gewöhnungsbedürftig. Auf einem Gassigang begegne ich einer Frau aus der Nachbarschaft, die sagt sie kenne „Clay’s mom“…Nachdem Samsons morgens immer eine ration Thunfisch bekommt, da er sonst seine Medizin nicht frisst, kaufe ich mir am dritten Tag auch mal Thunfisch. Bedenklich? Und: der neueste Schrei in den USA ist eine Dame namens ALEXA. Alexa ist eher ein Robotter als eine Dame, eine Robotterdame. Und eigentlich heißt sie Amazon Echo. Eine säulenförmige Lautsprecherbox von Amazon mit der man reden kann. „Alexa, play Country Music.“ – Alexa spielt Country Musik. „Alexa, what time is it?“ – alexa sagt einem die Uhrzeit, „Alexa, put coffee on the shopping list“ – Alexa schreibt einem die Einkaufsliste und schickt es direkt aufs iPhone. Verrückt! Gibt es in Deutschland übrigens noch nicht. Alle Technikfreaks, die schon ein Amazon Echo wollen: Bestellungen an mich!
Dann sind sie wieder da. Ein weiterer Abend mit Lachsbrot und Wein auf der Terrasse, mit Gesprächen über Reisen und Lebenserfahrungen (da höre ich dann eher zu). Ich bedanke mich für die schöne Zeit mit einem selbstgebackenen Bananabread, alles was ich gerade geben kann. Gil sagt, dass er die Gastfreundschaft zeigen möchte, die ihm früher während seiner backpack und hitchhiking Touren in Europa entgegengebracht wurde. Das hat er geschafft: Liz und Gil sind unter den liebenswürdigsten und interessantesten Menschen, die ich seit langem getroffen habe. Wir hätten noch so viel mehr zu bequatschen gehabt. Hier muss ich auf jeden Fall wieder vorbeischauen. Und zum Glück bin ich auch herzlich eingeladen.
Wer Lust hat Tier und Häuser zu sitten: http://www.trustedhousesitters.com kann ich empfehlen. Eine Mitgliedschaft kostet ca. $80 im Jahr, ihr erstellt euch ein Profil und dann könnt ihr euch auf die weltweite Suche nach Häusern machen. Da gibt es alles, von Ranch bis Chateau, mit Pferd und Geflügel, oder eben auch so ganz ’normale‘ Häuser mit Hund und Katze, wie das von Liz und Gil.
Last night, a cat set out for an adventure. Samson, an eager armchair traveler and domesticated cat, made his way across the country. He did not quite make it all the way to the west though – I guess he got tired since it was late. Instead, he found a comfortable spot in the countryside, somewhere between the east coast and the mid-west. The grass was as soft as a comfortable bed, a light breeze blew through his fur and it felt like the wind of a fan on the ceiling. As Samson fell asleep he dreamt of mountains and valleys, of coastlines and vast lands, of mice and men…
 Im Java Surf Cafe schüttelt mir Dwayne die Hand, fragt ob ich hier zu Besuch bin und nachdem ich nicke sagt er „this is gonna be your favorite Spot in Virginia Beach“. Damit könnte er recht haben. Hier hängen Bilder von Hawaiiblumen und Kolibis an den Wänden, Acryl auf Leinwand in tropischen Farben, Quallen und Seepferdchen und Landschaftsmalerien langer Küstenstreifen. Ich bin in Virginia Beach. Ich dachte nicht, dass nach New Jersey noch mehr beach life möglich ist. Hier aber mag ich das Flair noch viel lieber, das Wasser ist sauberer und es fliesst deutlich weniger Alkohol. Ausserdem kommen Delfine hinzu, mehr Wellen, freundliche Hunde und ganz viel Gastfreundschaft. Am Boardwalk zeugen Beach Cruiser Bikes mit den hohen Lenkern von einem wirklichen Strandleben, Pinien riechen und Grillenzirpen – fast Frankreich Flair, irgendwie mediterran. Weiterhin gibt es nur das barfuessige Dasein. Ricky traegt ihnehin nie Schuhe. Ich kenne Ricky und ihren Sohn Billy von Fuerteventura, den Februar ueber haben wir 2014 dort zusammen gewohnt und gesurft. Hier lerne ich ihr amerikanisches Leben und den Rest der McGarry Familie kennen. Wieder unter locals! Gleich am ersten Tag werde ich zum Segelbootreparaturgehilfen von Billy’s Vater Jim. Danach hole ich gleich sein Auto von der Werkstatt ab, cruise anschliessend mit Ricky’s Chevy Truck die Atlantic Avenue entlang, auf dem Weg halten wir an zwei surfshops und besuchen dann Billy bei seinem summer job in einem Fast food Restaurant. Der steht in Uniform am Grill und hackt bacon in Stücke. Nach ein paar stunden in Virginia Beach bin ich schon so angekommen und integriert, dass ich mich wie zu Hause fühle.
Im Java Surf Cafe schüttelt mir Dwayne die Hand, fragt ob ich hier zu Besuch bin und nachdem ich nicke sagt er „this is gonna be your favorite Spot in Virginia Beach“. Damit könnte er recht haben. Hier hängen Bilder von Hawaiiblumen und Kolibis an den Wänden, Acryl auf Leinwand in tropischen Farben, Quallen und Seepferdchen und Landschaftsmalerien langer Küstenstreifen. Ich bin in Virginia Beach. Ich dachte nicht, dass nach New Jersey noch mehr beach life möglich ist. Hier aber mag ich das Flair noch viel lieber, das Wasser ist sauberer und es fliesst deutlich weniger Alkohol. Ausserdem kommen Delfine hinzu, mehr Wellen, freundliche Hunde und ganz viel Gastfreundschaft. Am Boardwalk zeugen Beach Cruiser Bikes mit den hohen Lenkern von einem wirklichen Strandleben, Pinien riechen und Grillenzirpen – fast Frankreich Flair, irgendwie mediterran. Weiterhin gibt es nur das barfuessige Dasein. Ricky traegt ihnehin nie Schuhe. Ich kenne Ricky und ihren Sohn Billy von Fuerteventura, den Februar ueber haben wir 2014 dort zusammen gewohnt und gesurft. Hier lerne ich ihr amerikanisches Leben und den Rest der McGarry Familie kennen. Wieder unter locals! Gleich am ersten Tag werde ich zum Segelbootreparaturgehilfen von Billy’s Vater Jim. Danach hole ich gleich sein Auto von der Werkstatt ab, cruise anschliessend mit Ricky’s Chevy Truck die Atlantic Avenue entlang, auf dem Weg halten wir an zwei surfshops und besuchen dann Billy bei seinem summer job in einem Fast food Restaurant. Der steht in Uniform am Grill und hackt bacon in Stücke. Nach ein paar stunden in Virginia Beach bin ich schon so angekommen und integriert, dass ich mich wie zu Hause fühle.
Jemand hat idealer Weise die Wellenmaschine angeworfen, in ein paar Stunden geht es gegen low tide, dann ist es Zeit für eine surf session. Vom Haus sind es zwei Minuten runter zum Strand, Boards stehen genug im Garten. Besser geht es fast nicht. Am Abend bin ich platt von 4 Stunden water work-out, ein bisschen brauner und sehr sehr hungrig. Meine Haare filzen sich zu Dreadlocks, ein gutes Zeichen! Am folgenden Morgen stürmt Ricky um 6 Uhr in mein Zimmer und knipst recht brutal das grelle Deckenlicht an: Aufstehen! Surfen! Keinem Befehl folge ich lieber, wenn auch noch etwas verpennt. Wir fahren in die 1st street, Greg und ich surfen dort eine Stunde. Dann werden die Wellen zu lasch und wir fahren zu einem Spot weiter südlich, weitere drei stunden paddeln, surfen, warten, paddeln, surfen. Ich bin froh um den Kaffee und Donut, den wir vor der ersten Session hatten. Frühstück ist spaeter ein mehr als verdienter Pancake mit Bacon und Ahornsirup, im Belvedere, einem amerikanischen Diner im Stil der 60er jahre. Später im Surfshop kann ich kaum meine Arme heben, um durch die Tshirts zu schauen. Die Tage hier beginnen idealer Weise um halb sechs. Ricky ist so frueh schon mit den Hunden draussen, sie verpasst selten einen Sonnenaufgang. Der Morgen ist so friedlich hier, die Luft noch kuehl. Ich paddle um halb sieben mit dem Longboardhinaus, der Atlantik liegt still da, nicht mehr als eine Uferwelle rollt an den Strand. Nicht weit von mir gleiten Delfine durch einen Fischschwarm, Pelikane fischen aus der Luft, segeln dicht ueber der Oberflaeche – sie sind fuer den Sommer aus Florida hier hinaufgekommen. Ich weiss nicht, ob ich jemals zuvor so elegante Voegel gesehen habe. Zwischendurch fällt kurz warmer Sommerregen, der die 35 Grad nicht herunterkühlt, sondern die Luft noch schwüler macht. Das leben ist langsam, aber gut. Man braucht kaum zu essen bei dieser hitze.
Ein Ausflug nach Monticello ist kein Kurztrip nach Italien, viel mehr ein Ausflug in die Amerikanische geschichte. Gen Westen fahre ich mit Jim und Rickys Nichten zu Thomas Jeffersons Plantage Monticello. Jefferson, 3. Präsident der USA, hat sich dort ein hübsches Anwesen auf einem kleinen Hügel – „monti cello“, altitalienisch für „kleiner Berg“ – aufgebaut. Oder eher seine 600 Sklaven, die er während seiner Lebenszeit besaß. Eigentlich war er ja gegen Sklaverei. Naja, ist halt nicht so ganz logisch…Die Präsidenten kann ich immer noch nicht alle aufzählen, aber Jefferson werde ich wohl jetzt nicht mehr vergessen.














 Weiter geht es in Virginia Beach hier, mit hoch mehr Strand und Meer und Delfinen: https://blogmopped.com/2015/07/19/virginia-beach-the-beach-life-continues/
Weiter geht es in Virginia Beach hier, mit hoch mehr Strand und Meer und Delfinen: https://blogmopped.com/2015/07/19/virginia-beach-the-beach-life-continues/
 These Germans! Immer und überall sind sie unterwegs….Simona habe ich 2008 schon in Übersee, genauer in Neuseeland, getroffen – als sie mit ihrer Familie im Wohnmobil unterwegs und ich mit Lina work and traveln war. Dieses Jahr reisen Simona und ihr Freund Chris durch die USA. Wie das Schicksal es so will kreuzen sich unsere Wege wieder, fast rein zufällig, es braucht nur ein paar facebook Nachrichten. Die beiden sind auf dem Weg nach New York, die Ostküste hinauf, in ihrem in Iowa gekauften Auto. Mit Campingausrüstung von Stühlen bis Feuerholz und jede Menge Verpflegung im Pappkarton im Kofferraum – ein richtiges Roadtrip vehicle, ich bin begeistert. An diesem Morgen fahren sie um 10 Uhr, pünktlich deutsch, in der Robin Road vor als ich, pünktlich deutsch, gerade reisefertig mit Backpack und Gypsy Hut aus dem Haus trete. Mascha und Dan rasch im Halbschlaf good bye umarmt geht es für mich heute weiter. Chris und Simona fahren mich hoch nach New York, damit ich dort meinen Bus nach Virginia Beach erreiche. Was die geografische Logistik angeht etwas bescheuert, erst 2 Stunden nach Norden, dann wieder 7 Stunden nach Süden, aber so what, dafür bin ich schließlich hier: Unterwegssein. Außerdem kriege ich die beiden ein paar Stunden zu sehen. Sie erzählen von ihrem bisherigen Roadtrip, von dem Autokauf und Simonas Gastfamilie, die sie besucht haben, von Campingplätzen und der amerikanischen Gastfreundschaft, auch von gerade noch fertiggestellten Bachelor- und Masterarbeiten bevor die Reise losging und unnötig eingepackten Winterpullis. Reisende im Gespräch, ich fühle mich hier auf der Rückbank genau am richtigen Ort. Um das Verkehrschaos in Manhattan zu umgehen parken wir auf Staten Island und nehmen die Fähre hinüber. Die Skyline versinkt an diesem Nachmittag in Grautönen, die farblos gläsernden Wolkenkratzer lösen sich im Nebel auf. Schauer ziehen über die Bucht und lassen Lady Liberty im Regen stehen. Ohne den Fahrtwind auf der Fähre ist es ekelhaft schwül als wir den Broadway entlanglaufen, mein Rücken nass vom Backpack und die Schultern verkrampft. Ich muss unbedingt wieder hier raus, keine Stadt mehr, ich will zurueck an den Strand. Nach einem Abschiedscafe bei, natürlich, Starbucks mache ich mich auf den Weg den Bus nach Virginia Beach zu finden. Die Haltestelle ist nicht mehr als ein unscheinbares Schild in einer Straße, die vom Broadway abgeht. Zu meinem Glück sitzen an der Hauswand bereits einige Leute auf oder neben ihrem Gepäck. Es muss wohl richtig sein. Virginia beach, 7 stunden bus ride, here we go!
These Germans! Immer und überall sind sie unterwegs….Simona habe ich 2008 schon in Übersee, genauer in Neuseeland, getroffen – als sie mit ihrer Familie im Wohnmobil unterwegs und ich mit Lina work and traveln war. Dieses Jahr reisen Simona und ihr Freund Chris durch die USA. Wie das Schicksal es so will kreuzen sich unsere Wege wieder, fast rein zufällig, es braucht nur ein paar facebook Nachrichten. Die beiden sind auf dem Weg nach New York, die Ostküste hinauf, in ihrem in Iowa gekauften Auto. Mit Campingausrüstung von Stühlen bis Feuerholz und jede Menge Verpflegung im Pappkarton im Kofferraum – ein richtiges Roadtrip vehicle, ich bin begeistert. An diesem Morgen fahren sie um 10 Uhr, pünktlich deutsch, in der Robin Road vor als ich, pünktlich deutsch, gerade reisefertig mit Backpack und Gypsy Hut aus dem Haus trete. Mascha und Dan rasch im Halbschlaf good bye umarmt geht es für mich heute weiter. Chris und Simona fahren mich hoch nach New York, damit ich dort meinen Bus nach Virginia Beach erreiche. Was die geografische Logistik angeht etwas bescheuert, erst 2 Stunden nach Norden, dann wieder 7 Stunden nach Süden, aber so what, dafür bin ich schließlich hier: Unterwegssein. Außerdem kriege ich die beiden ein paar Stunden zu sehen. Sie erzählen von ihrem bisherigen Roadtrip, von dem Autokauf und Simonas Gastfamilie, die sie besucht haben, von Campingplätzen und der amerikanischen Gastfreundschaft, auch von gerade noch fertiggestellten Bachelor- und Masterarbeiten bevor die Reise losging und unnötig eingepackten Winterpullis. Reisende im Gespräch, ich fühle mich hier auf der Rückbank genau am richtigen Ort. Um das Verkehrschaos in Manhattan zu umgehen parken wir auf Staten Island und nehmen die Fähre hinüber. Die Skyline versinkt an diesem Nachmittag in Grautönen, die farblos gläsernden Wolkenkratzer lösen sich im Nebel auf. Schauer ziehen über die Bucht und lassen Lady Liberty im Regen stehen. Ohne den Fahrtwind auf der Fähre ist es ekelhaft schwül als wir den Broadway entlanglaufen, mein Rücken nass vom Backpack und die Schultern verkrampft. Ich muss unbedingt wieder hier raus, keine Stadt mehr, ich will zurueck an den Strand. Nach einem Abschiedscafe bei, natürlich, Starbucks mache ich mich auf den Weg den Bus nach Virginia Beach zu finden. Die Haltestelle ist nicht mehr als ein unscheinbares Schild in einer Straße, die vom Broadway abgeht. Zu meinem Glück sitzen an der Hauswand bereits einige Leute auf oder neben ihrem Gepäck. Es muss wohl richtig sein. Virginia beach, 7 stunden bus ride, here we go!
 Beach voices of the New Jersey shore, summer 2015
Beach voices of the New Jersey shore, summer 2015
Dan: „The hardest thing in my life is to put on a bathing suit in the morning. Sometimes I even forget what day it is.“
Sue: „During the summer, we leave the beach only for weddings and funerals.“
 New Yorks Penn Station liegt an der 34. Straße im Herzen Manhattans. Von hier fahren die Züge ins ganze Land. Meinen Rucksack auf dem Rücken stapfe ich durch die wuselnde Masse zum Schalter des New Jersey Transit, ein Zug der mich nach Sueden an die Küste New Jerseys bringen soll, genauer: nach Long Branch, zu Mascha.
New Yorks Penn Station liegt an der 34. Straße im Herzen Manhattans. Von hier fahren die Züge ins ganze Land. Meinen Rucksack auf dem Rücken stapfe ich durch die wuselnde Masse zum Schalter des New Jersey Transit, ein Zug der mich nach Sueden an die Küste New Jerseys bringen soll, genauer: nach Long Branch, zu Mascha.
7 Tage später. Ich hatte nicht geplant hier eine ganze Woche zu bleiben. Aber der Strand ließ mir praktisch keine Wahl, es war an der Zeit wieder braun zu werden, wieder Shorts und Bikini zu tragen, barfuß auf warmem Asphalt zu laufen. Die Jersey Küste um Long Branch und Sea Bright hat den Charme eines filmreifen amerikanischen Sommerausflugs ans Meer: Eine Strandmeile mit kleinen Geschäften, in denen es Schwimmtiere und maritime Mitbringsel zu kaufen gibt, dazwischen bieten schicke Restaurants mit Cocktailbars entlang des Boardwalks Austern und Champagner an. Strandstühle – beach chairs – mit Kühlfächern und Sonnenschirme sind die bunten Tupfer des langen Sandstrandes und ein must-have. Große Parkplätze für viele grosse Autos lassen auf die Beliebtheit des Kuestenstreifens schliessen, dazu verlangt an jedem Strandzugang ein kleines Häuschen 8$ ‚Kurtaxe‘ für das sandige Erlebnis. Vom Strand aus kann man bei gutem Wetter New York sehen, von dort kommen die Besucher am Wochenende in Scharen. ‚Benny‘, so nennen die locals abwertend diese sommerlichen Besucher – damit ist der Spitzname übrigens für mich schon mal ausgeschlossen.
Die Tage hier haben keinen Takt, sie fließen dahin. Vom morgendlichen Bagel – New Jersey Pork Roll! – oder Eggs, Bacon und Wheetgras Shots, direkt an den Strand, ins Meer die Hitze ertränken und den Schweiß abwaschen, Volleyball am Nachmittag oder Abend, dann in die die nächste Bar, oder auch in die German Beer Hall in Asbury, als Finale in der Hot Tub Nachts die Sterne beobachten, nicht ohne frisch gezapftes Bier von der hauseigenen Terrassenbar natuerlich . Eines ist mir jetzt klar: Die Prohibition war die dümmste Idee, die amerikanische Politiker jemals hatten. Hier ist Alkohol im Spiel. Für den ersten Volleyball Abend am Strand von Sea Bright ist das wörtlich gemeint – Liz, die uns mit Getränken beliefert, grinst vom Spielfeldrand aus, als wir den ersten Schluck vom Gatorade nehmen, ein Sportgetränk, das jetzt verdächtig nach Vodka schmeckt. Dabei habe ich den Cocktail im Beachclub schon fast vergessen, den wir vor dem Spiel als Auftakt geschlürft haben. Danach geht es direkt weiter ins DIVE, eine Bar an der Meile von Sea Bright. Nicht unbedingt bekannt für die besten Drinks, wie mir Maschas Freund Dan der Bartender erklärt, aber das Essen ist hervorragend, vor allem die Tacos mit Pulled Pork und die Austern – ein Bier dazu geht natürlich auch hier. Darauf folgt noch eins, dann kommt der Zimtschnaps Fireball und mir klingen die Glocken in den Ohren und draußen rieselt leise der Schnee – schmeckt wie Weihnachten. Alle Bars hier sind jedoch Nichts gegen Donovan’s. Donovan’s! Vor zwei Jahren wurde die beliebte Strandkneipe von Sandy zerstört, der Supersturm hat hier fast die gesamte Küste zusammengeweht. Heute, zwei Jahre später, sind die meisten Schäden behoben. Die Menschen haben ihre Häuser wieder aufgebaut, der Strand ist wieder breiter geworden, weil im Winter Sand durch große Rohre vom Meeresgrund ans Ufer gepumpt wurde. Nur Donovan’s blieb bisher geschlossen. Vor ein paar Wochen machten Gerüchte die Runde, Hey, habt ihr das auch gehört, Donovan’s öffnet seine Tikibar am Strand wieder! Dieses Wochenende war es tatsächlich soweit. Seit Freitag um 10 Uhr gibt es kein anderes Thema mehr, geschäftiges Räumen an der Bar, die ersten Kunden warten gespannt und beobachten jede Regung des Personals. Ungeduld macht sich breit. Mir ist der Alkohol ziemlich schnuppe, irgendwie finde ich das alles hier sogar ziemlich nervig und lächerlich, jedes zweite Wort ist BEER!, booze ist das Hauptthema, immer und ueberall. Aber die Spannung in der Luft macht sogar mir als Touri klar, wie besonders diese Wiedereröffnung sein muss. Dann irgendwann zischt die erste Dose Bier und ab da gibt es kein Halten mehr. Samstag Abend: Wir sitzen im Sand, der Ice Tea hat einen im Tee und wir auch bald, während wir halb ernst halb albern auf Bruce Springsteen warten. Bruce ist hier in New Jersey zu Hause und das letzte Mal ist er wohl tatsächlich im Donovan’s aufgetaucht und hat ein kleines Spontankonzert gegeben, in Latzhose und mit Cap. Heute Abend taucht der Boss nicht auf, aber der DJ mischt in die Chartmusik des Tages langsam die Elektrorythmen der Nacht. Beachgirls in kurzen schwarzen Kleidern schwingen die Hüften, an der Tikibar dauert es 20 Minuten bis ich einen Drink bekomme. Die Hawaiiketten am Bambushäuschen der Tikibar schwingen in der leichten Brise, die Scheinwerfer beleuchten den Strand und den instabilen Bambuszaun, der uns symbolisch vom restlichen Teil des Strandes abtrennt. Hier ist trinken erlaubt, ‚ dort draußen‘ selbstverständlich nicht. Deshalb ist Donovan’s so eine sensation: Ganz offen und das legal am Strand trinken können, ohne die Bierdose im Shirt einzuwickeln oder den Alkohohl in Trinkflaschen umfüllen zu müssen. Kannste ja keinem Europäer verkaufen, dass Trinken am Strand etwas Außergewöhnliches ist. Aber hier eben schon…Der Sonntag ist dann ein richtiger Sonntag. Auf der Garagenauffahrt steht der dicke Grill, davor parken die dicken Autos. Es gibt BBQ: Ribs. Coleslaw. Mudpie. Sangria Bowle. Und wie sollte man den Tag anders überstehen: Budwiser. Budwiser. Budwiser. Ich lerne Kan Jam und Cornhole – zwei Spiele für den Garten, so normal hier wie Bodgia oder Federball bei uns. Dieser Trip ist wahrhaft eine kulturelle Studie, ich bin mittendrin in der amerikanischen Kultur.
Kommen wir zum Wasser. Da faellt mir ein: Haie. Diese Woche ist „Shark Week“ im Discovery Channel, der laeuft im Dive non-stop. Menschen tauchen in Käfigen zu den grossen Weissen hinab, andere lassen sich in Kettenhemden von den Viechern anknabbern oder versuchen sie auf den Rücken zu drehen und so in Trance zu versetzen. Berichte von Haiangriffen und fehlenden Gliedmaßen, von wissenschaftlicher Forschung und Erkenntnissen. Man soll ja nicht so gegen Haie haten, wieder kommen die Argumente auf ‚es sterben mehr Menschen durch Hunde, Sektkorken und Kokosnüsse‘, aber ein mulmiges Gefühl bleibt. Besonders, weil es dieses Jahr hier an der Ostküste schon diverse Sichtungen und einige Attacken gegeben hat. Super Vorbereitung: Dan nimmt Mascha und mich mit zum Surfen, ein paar kleine Wellen spuckt die Ostküste für uns aus. Sobald ich auf dem Brett über den ersten Wellenberg hinweg paddle, die Gischt auf den Lippen schmecke und die Paddelbewegung sich wieder wie das Natürlichste der Welt anfühlt, sind alle Haie laengst vergessen. Endlich wieder surfen! Es ist so heiß, an einen Neoprenanzug ist nicht zu denken. Im Badeanzug gibt es von der Sonne gleich eine Quittung, in Form eines runden Kreises auf dem Rücken und rote Schultern. An meinem letzten Morgen floaten wir im sommerlichen flow einen Fluss hinunter – Dan auf dem Stand up paddle Board, Mascha auf einer komfortablen Luftmatratze mit Rückenlehne und ich auf einem eher weniger komfortablen Reifen, der eigentlich eine snow tube ist. Die Leute auf den Booten winken uns zu und gucken ein bisschen verwirrt. Die Tide ist entscheidend. Jetzt treibt uns die Flut in Richtung Norden, später soll die Ebbe uns zurück bringen. Dafür müssen wir warten, Wo? Natürlich in einer Bar Schrägstrich Restaurant. Ganze vier Stunden Sonne, Drinks, Food und Schwimmen. Dabei beobachten wir den Fluss, sehen wie die Strömung sich verlangsamt, wie kleine Wellen und Wirbel entstehen und wie schließlich, ganz langsam, das Wasser in die andere Richtung zu fließen beginnt…
 Weiter geht es hier: Richtung Virginia Beach, hitching a ride mit Simona und Chris….https://blogmopped.com/2015/07/14/hitching-a-ride/
Weiter geht es hier: Richtung Virginia Beach, hitching a ride mit Simona und Chris….https://blogmopped.com/2015/07/14/hitching-a-ride/
Die Kästen der Airconditions schwitzen auf den Gehweg und hinterlassen nasse Flecken. Daneben platscht Taubenkacke dampfend auf den Asphalt. Von den schwarzen Müllsäcken am Straßenrand steigt übel riechende Luft auf, daneben rinnt braune Brühe die Gosse hinab, dem Zebrastreifen entgegen, und mündet in einem Müllstrudel aus plastic bottles und gelblichem Schaum. Die Stadt ist mir nicht fremd, aber ich habe sie noch nie in ihrem Sommerkleid gesehen, geschweige denn gerochen. Vor zwei Jahren trug sie Pelzmantel und Ohrenschützer, Stiefel und Strumpfhosen. Da waren die Bäume des Central Parks blattarm und eissteif, jetzt grünt und blüht es hier und Vögel hüpfen und zwitschern, als wollten sie der Stadt eine ländliche Idylle überstülpen. Segelboote bevölkern den Hudson River, daneben paddeln Kayakfahrer im Strom und Sonnenanbeter biegen sich in Yogaformation auf den Grünflächen am Fluss. Modisch zeigt sich der Sommer in allen Formen und Farben, von Hotpants bis Blümchenkleid. Bauchfrei scheint wieder in zu sein.
Ich schnüre die Laufschuhe um 5:52 Uhr, der Jetlag hat mich noch fest im Griff. Die 30 Grad des gestrigen Tages liegen noch in der Luft. Es ist schwül als ich aus den Jefferson Towers trete, immerhin kühler als tagsüber. Eine leichte Brise weht durch die Straßenschluchten. Ich trabe los, die 95. Straße nach Westen quere ich die Amsterdam Avenue und den Broadway. Am Hudson ist um diese Uhrzeit schon Betrieb, den neonfarbenen Läufern und Radfahrern gehören die lanes des Riverside Park. Ich reihe mich ein in den frühsportlichen Wahnsinn. Ein Stand up Paddler arbeitet sich nahe des Ufers stromaufwärts nach Norden, einige Minuten gleiten wir nebeneinander her, vorbei an den Booten, deren Masten und Rümpfe rötlich gefärbt sind von der aufgehenden Sonne.
Später am Tag rast das NYPD unter hektischer Sirene durch den Central Park, in dem die New Yorker – und ich – auf Wiesen und Felsen in der Mittagspause entspannen. Überall Sirenen. Und Parks! Die Stadt ist süchtig nach grün, der Asphaltdschungel braucht richtigen Dschungel zum Ausgleich, die gläsernen Fassaden wollen grün spiegeln. Im Prospect Park in Brooklyn steigt ein Drache auf und Grillgeruch in die Nase, kleine bunte Grüppchen tollen mit Bällen und Hunden auf der großen Wiese hinter der Grand Army Plaza. New York ist ein beispielloser meting Pot. Hautfarben, Gesichtszüge, Körpermaße – alles schmilzt hier in der Hitze zu einer Einheit und bleibt gleichzeitig in seiner Vielfalt erhalten. „Happy 4th“ klingt an meine Ohren. Independence Day. Ob ich mir den Zeitpunkt meiner Ankunft bewusst ausgesucht habe,für einen richtig amerikanischen Einstieg? Not really…aber hier macht sich ohnehin jeder ein bisschen über übertriebenen Nationalstolz lustig. Beim Feuerwerk später versperren die Wolkenkratzer mir so sehr die Sicht, dass ich das Spektakel eigentlich nur akustisch verfolgen kann. Es hallt in den Hochhauscanyons. Nun ja, optisch ist zumindest die Reflektionen in den Fassaden drin.
Governor’s Island liegt nicht weit vom Festland, südlich der Spitze von Manhattan. Wir brettern mit der Fähre über den Buttermilk Channel hinüber und finden wieder ein Park. Die Insel ist ein ehemaliges Militärgelände auf dem heute Foodtrucks ihre Burgerpatties grillen, Touristen die Aussicht auf die Skyline und Lady Liberty genießen und auf der weitläufigen hügeligen Wiese rund um das Hauptgebäude die Picknickdecken ausbreiten. Trotz der Besucherscharen, die hier jede Stunde mit dem Boot einfallen, verteilen sich die Massen schnell. Keine Spur von der Hektik Manhattans. So klingt der Tag aus, wir nehmen die Fähre zurück aufs Festland und streifen mit der untergehenden Sonne durch den dicht bevölkerten Brooklyn Bridge Park der Subway entgegen. New York, New York – es war schön dich wiederzusehen, aber ich glaube das reicht mir jetzt mit Stadt. Es ist Zeit aufzubrechen…
Bestes Bild, purer Zufall: Minion und Banana vereint. Bananaaaaaa…

„Miss, you are ready to fly“ leuchtet die Schrift auf dem Bildschirm mir entgegen. Ha, Scherzkeks. Ich habe eingecheckt, so weit so gut. Aber um mich herum liegen Klamotten verstreut auf dem Boden, Häufchenbildung nennt sich das im Fachjargon des Packexperten. Das kommt mit, das da vielleicht, die Sachen von dem Haufen dort drüben müssen wohl oder übel wieder in den Schrank. Stück für Stück siebe ich aus, ein Eliminierungspackgang nach dem anderen bis irgendwann alles in den Rucksack passt. Nach Jahren des Reisens habe ich immer noch nicht dazugelernt, unbelehrbar in Sachen effizienter Packerei. Aber immerhin, jetzt bin ich wirklich ready to fly.
Die Nacht ist schon lange hereingebrochen. 0:11 Uhr schlägt keine Uhr, aber zeigt das iPhone. In fünf Stunden und vierzig Minuten geht mein Flieger, nur an Schlaf ist heute Nacht nicht zu denken. Viel eher ist nun Zeit, die Banalität des Packens hinter sich zu lassen, den organisatorischen Teil der Reisevorbereitung abzuschließen und sich Höherem zu widmen: der Philosophie des Unterwegsseins. Das bedeutet so viel wie den Gedanken hinter dem Aufbruch Raum zu geben. Warum tue ich das? Viel Geld ausgeben, lange von zu Hause weg sein, mich in die Ungewissheit wagen? Neben mir auf dem Schreibtisch liegt Rolf Potts „Vagabonding. An uncommon guide to the art of Long-term World Travel“ als Untertitel. Mit einem noblen Zitat von keinem anderen als dem weisen Walt Whitman ließe sich diese philosophische Stunde einläuten. In seinem „Song Of The Open Road“ heißt es „From this hour I ordain myself loos’d of limits and imaginary lines, Going where I list, my own master total and absolute, Listening to thers, considering well what they say, Pausing, searching, receiving, contemplating, Gently, but with undeniable will divesting myself of the holds that would hold me.“ Mutig und enthusiastisch, fast kompromisslos. Das erinnert mich daran, dass ich mir auf dem Weg einen Gedichtband von Whitman zulegen sollte, um den amerikanischen Geist des out-of-doors und on-the-road Seins im Gepäck zu haben. Whitman also zur Motivation, als Warnung und Ratschlag nehme ich Eamonn Gearons: „Don’t travel in order to get away from any place. Do it to be wherever you are that night when you go to sleep. And if you are not happy with where you are or what you are doing, it is all right to move on, or just give up and go home.“ Das erinnert mich an Allain de Bottons „Man nimmt sich immer selbst mit auf die Reise.“ Vor allem aber spricht mir Don Blanding aus der Seele:
Double Life
by Don Blanding
How very simple life would be
If only there were two of me.
A Restless Me to drift an roam,
A Quiet Me to stay at home.
A Searching One to find his fill
Of varied skies and newfound thrill,
While sane and homely things are done,
By the Domestic other One.
And that’s just where the trouble lies,
There is a Restless Me that cries
For chancy risks and changing scene,
For arctic blue and tropic green,
For deserts with their mystic spell,
For lusty fun and raising Hell.
But shackled to that Restless Me,
My Other Self rebelliously
Resists the frantic urge to move.
It seeks the old familiar groove
That habits make. It finds content
With hearth and home – dear prisonment,
With candlelight and well-loved books,
And treasured loot in dusty nooks.
With puttering and garden things
And dreaming while a cricket sings
And all the while the Restless One
Insists on more exciting fun,
It wants to go with every tide,
No matter where…just for the ride.
Like yowling cats the two selves brawl
Until I have no peace at all.
One eye turns to the forward track,
The other eye looks sadly back.
I’m getting wall-eyed from the strain,
(It’s tough to have an idle brain)
But One says „Stay“ and One says „Go“
And One says „Yes“ and One says „No“,
And One Self wants a home and wife
And One Self craves the drifter’s life.
–
The Restless Fellow always wins
I wish my folks had made me twins.
…durch Goethes Feder gesprochen: „Zwei Seelen wohnen, ach! In meiner Brust.“ Eine Ode an Heimweh und Fernsucht, ein Prost auf die endlosen Möglichkeiten, gelobt und verflucht sei die Unfähigkeit zur klaren Entscheidung und die ewige Zerrissenheit.
Zuletzt habe ich von Lini ein Gedicht mit auf die Reise bekommen. „A good traveler is one who does not know where he is going to, And a perfect traveler does not know where he came from.“ (Lin Yutang) Ich bin mir ziemlich sicher, dass es mir reicht, ein guter Reisender zu sein. Laut Blanding: Ein Restless Fellow auf Zeit, aber dann auch wieder ein Domestic Self. Das Blogmopped wird also für ein viertel Jahr, sprich drei Monate, 12 Wochen, oder 90 Tage, die Farben der amerikanischen Flagge tragen, ich den Backpack und wir gemeinsam tragen die Sehnsucht nach dem Abenteuer, hoffentlich bis an die Westküste und zurück. Keinen Tag länger, bis zum 30. September – was mir der Grenzbeamte bei der Einreise noch mal unmissverständlich klar gemacht hat, „Make sure you leave the country!“. Keine Panik, ich will ja gar nicht bei euch Amis bleiben. Ich will nur mal gucken…
…First stop: New York, New York.
Hätten wir geahnt was kommt, ich weiß nicht, ob wir es nicht gelassen hätten. Hätten wir doch bloß mehr Radieschenschwänzchen* gegessen, um drahtiger zu werden. Im Nockherbergbiergarten am Abend zuvor vielleicht eine Maß weniger getrunken, länger geschlafen und ganz sicher die Wanderstiefel vorher mehr eingelaufen. So richtig hatte auch irgendwie keiner auf die Karte geschaut, die Enge der Höhenlinien hatte niemanden alarmiert. Aber so konnten wir wenigstens mal den Schweinehund Gassi führen und wir haben auch unseren Auslauf bekommen.
Wie ein norwegischer Fjord windet sich der Königssee dunkel und schmal durch das Tal, rechts und links steigen bewachsene Berghänge aus dem Wasser empor. Es wirkt, als habe der See die grobe Geologie besänftig und den Riss zwischen zwei mächtigen Felsmassiven wie eine Badewanne ausgefüllt. Nur, dass er auf Badende wenig einladend wirkt, selten ist ein Strand zu sehen und 192m vertikale Dunkelheit an der tiefsten Stelle lassen einen friedlichen Schwimmer eher erschaudern als frohlocken. Wenn man mal eine Leiche verschwinden lassen möchte … Karo verlegt ihr für den Rückweg geplantes Triathlontraining gedanklich gleich mal lieber in den Chiemsee. Es ist 9:45 Uhr. Wir schippern still dahin, kein Windhauch kräuselt die Wasseroberfläche. Es ist schwül, Gewitter sind für den frühen Nachmittag vorhergesagt. Laut Radio könnte später auch die Welt untergehen. Wir sind früh in München aufgebrochen um dem Schlimmsten zu entgehen, die Tour abzusagen kam nicht in Frage. Es wird schon gut gehen! Als der Bootsführer beginnt gegen die berühmte Echowand zu trompeten ist die Harmonie so perfekt wie trügerisch.Die Karte ausgefaltet auf dem Schoss nochmal die Route abgehen. Wir rechnen mit 6 Stunden, 7 mit Pause vielleicht. Das hat meine Recherche ergeben. Matthias misst mit den Fingern die Kilometer an den Kästchen nach, hier sehen die Höhenlinien eng aus, steile Anstiege, da ist es besser, wir entscheiden uns am ersten Tag einen anderen Weg zu nehmen als ursprünglich geplant.
St Bartholomä ist ein konstruiertes Idyll, gemacht für Pauschaltouristen, die in Gruppen tagtäglich in das kleine ehemalige Fischerdorf mit der zwiebeltürmigen Kirche strömen. Vom Boot spazieren sie entlang des Pfades am See, wer es weit bringt schlappt noch ein paar abenteuerliche Meter ins weißkiesige Flussbett, dann schleunigst in den Biergarten und zurück aufs Boot. Wir schieben uns durch die Massen an ihnen vorbei, stechen aus der Menge heraus durch unsere klobigen Wanderschuhe, die bunten Rucksäcke und ganz sicher durch unsere Jugendlichkeit. Ein letztes Vorher-Foto, dann reihen wir uns ein, wie eine Seilschaft marschieren wir zu acht entlang des Ufers. Bald beginnt der Weg anzusteigen und die Schwüle lässt den Schweiß tropfen, dann rinnen. Die Hemden werden fleckiger, aber noch sind wir guten Mutes. Es geht bergauf, wir sind wohlauf und die Beine noch nicht müde. Der Wald spendet Schatten. Das Schwein im Rucksack grunzt zufrieden, es freut sich über die Bergluft in seinem Rüssel. Nach einer Stunde eine erste kleine Bergrast im Wald, Südtiroler Schinken und Pustertaler Bergkäse geben eine (Achtung Wortwitz!) ‚wandervolle’ Vesper ab, Joseph klemmt das Brot unter den Arm und schneidet dicke, unregelmäßige Scheiben mit dem Taschenmesser davon ab.
Weiter hinauf, ruft der Berg. So folgen wir und lesen auf den Schildern noch immer nicht Ingolstädter Haus. Wir schrauben uns hinauf, bald über mehr Stein als Stock, Meter für Meter. Der Höhenmesser in Bastis Uhr ist unsere Hoffnung, dass die Zielhöhe – 2100m – bald erreicht ist, und unsere Verzweiflung, weil er so langsam nach oben kriecht. Als der Wasservorrat nach drei Stunden knapp wird füllen wir an einem kleinen plätschernden Bach die Reservoirs wieder auf. Kaltes Wasser rinnt vom Berg durch Gesteinsschichten direkt in unsere Flaschen, wir trinken, füllen wieder auf, trinken, füllen wieder auf. Das Gesicht und die Handgelenke gekühlt trägt die Frische ein Stück den Berg hinauf. Aber bald verdunstet die Erleichterung mit dem Wasser in der Hitze des Nachmittages. Das Schwein mutiert langsam aber stetig zum Schweinehund und grunzt gehässig in meinen Nacken.
Dann rollt das Gewitter heran. Es kracht das erste Mal in der Ferne, die Bergkette am Horizont hinter uns ist in eine dunkle bedrohliche Wolke gehüllt. Wir hasten voran, wissend, dass der auffrischende Wind nichts Gutes bedeuten kann. Die Blicke wandern zum Wegesrand, noch sind wir nicht schutzlos ausgeliefert. Felsbrocken können Schutz bieten. Aber je weiter wir uns hinauf bewegen, desto freier wird das Gelände. Die ersten schweren Tropfen fallen und alle Hoffnung, dass das Wetter an uns vorbeizieht, hat sich in leichte Panik aufgelöst. Ich murmle vor mich hin, das ist nicht gut, was tun? Jetzt schon hinhocken? Nicht hinlegen, zu viel Kontakt zum Boden, hocken ist besser, und alles Metall weg vom Körper. Es grollt wieder. Der Weg biegt sich um eine Ecke, dahinter taucht in einiger Entfernung ein silberner Mast auf, der aussieht wie eine Antenne. Sie reckt sich dem Himmel entgegen als würde sie um den nächsten Blitzschlag betteln. Nicht gut! Nicht näher ran! Karo und Matthias waren schon ein Stück voraus, sie kommen zurück und deuten auf den gegenüberliegenden Hügel, eine Hütte! Mit einem Puls von mindestens 180 kommen wir oben an, mittlerweile hat es kurz gehagelt. Eine Jägerhütte, verschlossen, und ziemlich ausgesetzt…aber wir verharren hier 20 Minuten bis das Gewitter abzieht. Bald sind die Regenjacken wieder zu warm, der graue Himmel längst vergessen. Sonnentag!
Wie weit noch? 3 Stunden steht auf dem nächsten Schild, ein bisschen steht allen der Schock ins Gesicht geschrieben, wir sind seit 4,5 Stunden unterwegs. Immer noch drei? In diesem Moment kann sich keiner vorstellen noch so lange zu laufen. Aber weiter hinauf, ruft der Berg, und wir folgen. In einen Kessel hinein, die ersten Schneefelder überqueren und dann eine Steigung, die mehr Klettern als Wandern erfordert. Aber hier machen wir fast 250 Höhenmeter gut, es geht voran. Eine Frauengruppe, die uns entgegenkommt, sagt es seinen keine weiteren Gewitter mehr vorhergesagt. Mehr Schneefelder kreuzen unseren Weg und wir die Schneefelder, wir steigen wie auf Stufen, die in den Schnee getretene Fußabdrücke sind. Nach jeder Kuppe scannen wir die Landschaft, wann taucht endlich das Ingolstädter Haus auf? Mittlerweile sind es 7 Stunden, ohne große Pause. Eine weitere müssen wir noch aushalten, dann haben wir es geschafft. Im Schatten des großen und kleinen Hundstod liegt unsere Hütte. Wir sind da! 18 Uhr. Der einzige Wunsch eines Verdurstenden ist ein Glas Wasser, der einzige Wunsch eines erschöpften Wanderers ist es die Schuhe auszuziehen. Und ein Getränk. Aber statt Wasser vielleicht eher eine Apfelschorle oder ein Russ oder ein Skiwasser.
Der Rest ist schnell erzählt. Essen, Duschen, Schlafen. Am nächsten Morgen brechen wir nach einem reichhaltigen Frühstück um 8:00 Uhr auf. Vor uns liegen 6 Stunden Abstieg, sechs Stunden Tortur für Knie und Schienbeine. Und so mancher hat sich heftigste Blasen bei dem gestrigen Gewaltmarsch erarbeitet, „leichte Rötungen“ wie Joseph es galant formuliert. Aber mittlerweile können wir leiden. Und das Wetter ist uns wohlgesonnen, Sonne bescheint uns und scheint uns zu dieser frühen Stunde schon viel zu warm. Wir laufen und laufen, sehen Murmeltiere und pausieren am Kärlingerhaus, das sich mit dem romantischen Funtensee und leckerem Käsekuchen schmückt, schmeckt auch um 10 Uhr am Vormittag. Die Saugasse hat ihren Namen verdient und tut nochmal richtig weh, bergab geht es in harten, steilen Zick-Zack Kehren, aber da wir nichts lieber als Höhenmeter verlieren wollen ist dieser Abstieg nur effektiv. Das Hikers’ High setzt danach ein, an einer Kreuzung im Wald verkündet ein gelbes Schild: noch eine Stunde bis St. Bartholomä. Challenge accepted! Im Stechschritt geht es hinunter, aller Schmerz vergessen, wie Pferde, die den Stall wittern, traben wir dem See entgegen.
Als es vollbracht ist noch schnell ein Nachher-Foto und dann schälen wir die Schuhe mit der Haut von den Füßen. Trotz Schmerz: wir haben die Freiheit wiedererlangt! Ein Fußbad im See und dann springen wir in Adiletten auf das nächste Boot, mit den unschuldigen Pauschaltouristen, die soeben aus dem Biergarten gefallen sind und nun aus der Harmonie, da sie mit großen Augen die Rötungen an Bastis Fersen inspizieren. „Sie haben aber nicht solche Blasen, oder?“ fragt mich eine ältere Dame ganz schockiert. Ich schüttle den Kopf und Blicke über den See, die steilen Felswände hinauf. Bald müssen wir die nächste Tour planen!
*zur Radieschenschwanztheorie: So eine irrwitzige Biergartentheorie, entstanden bei Obatzter und Bier.
WENN MAN NIEMAND IST….
….KANN MAN JEDER SEIN
Ich habe mir lange Zeit den Kopf darüber zerbrochen, wer ich bin, wer ich sein will und wer ich sein sollte. Heute weiß ich, dass ich niemand bin, dass ich niemand bestimmtes sein will und dass das auch so sein soll. Wieso? Na weil es toll ist, sein zu können, wer immer man will! Jeder Mensch, der mehr emotionalen Tiefgang als eine Luftmatratze besitzt, trägt mehr als nur eine Persönlichkeit in sich, hat mehr als nur ein Talent. Jeder kann „mehr“ sein. Sich selbst auf etwas festzulegen, ist für den denkenden Menschen wohl nicht nur langweilig, sondern auch mehr als ermüdend. Wenn man sich darauf einlässt, ist es unglaublich spannend, sich zu entdecken, selbst wenn einem nicht alles gefällt, was man dabei findet. Es gibt fast nichts, dass sich gegenseitig ausschließt, auch wenn uns die Gesellschaft immer noch versucht das Gegenteil einzutrichtern. Man muss nur in sich hinein hören und ab und zu einem spontanen Impuls folgen um zu wissen was für einen selbst stimmig ist. Wenn du etwas tun willst, mach es einfach, mache es „um zu wissen wie es ist“. Wieso soll man nicht einerseits einem Handwerk nachgehen bei dem der Altersschnitt 50+ beträgt und gleichzeitig Sänger einer Hardcore-Band sein? Wieso soll man sich nicht dazu berufen fühlen, als Nachhilfelehrer Menschen Mathematik näher zu bringen und sich (weil man es schön findet) am ganzen Körper tätowieren lassen? Wieso nicht die Natur lieben und kein Problem damit haben ganze Wochenenden mit Starcraft II „verschwenden“?
(Franz Josef Keilhofer)
Quelle Text: http://www.gingerwood.de/de/blog/wenn-man-niemand-ist/
Quelle Bild: http://bit.ly/1GsHc18
Mehr Info inkl.Video: http://www.welt.de/reise/deutschland/article141058243/Taetowierter-Hipster-wirbt-fuer-Urlaub-in-Bayern.html